| Basis-Ausgangslage |
| [] Die Grundlagen zum Thema wurde in einem WOL-Circle (und #meinziel22) erstellt |
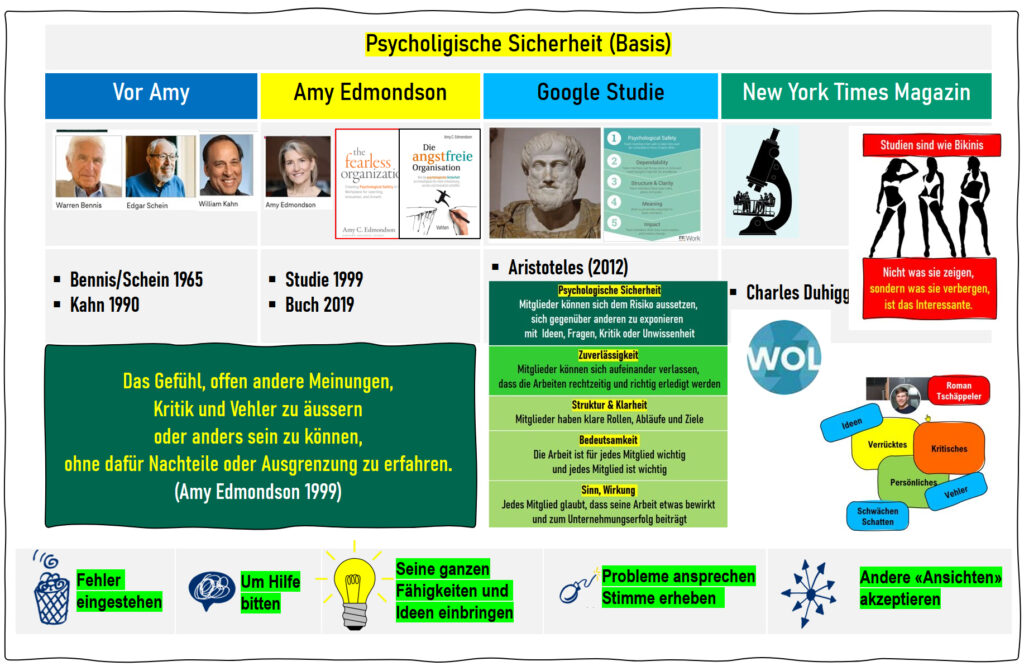
| Post zum Thema | Hinweise intern | Externe Links |
|---|---|---|
| [] ich hier | [] Basis-Verhalten | [] Masterarbeit [] Projekt-Magazin [] Guter Artikel |
| [] Übersicht [] noch anschauen |
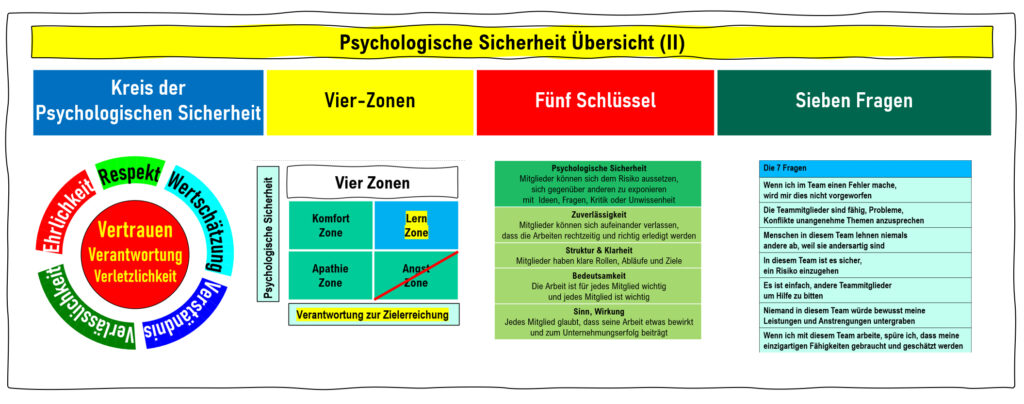

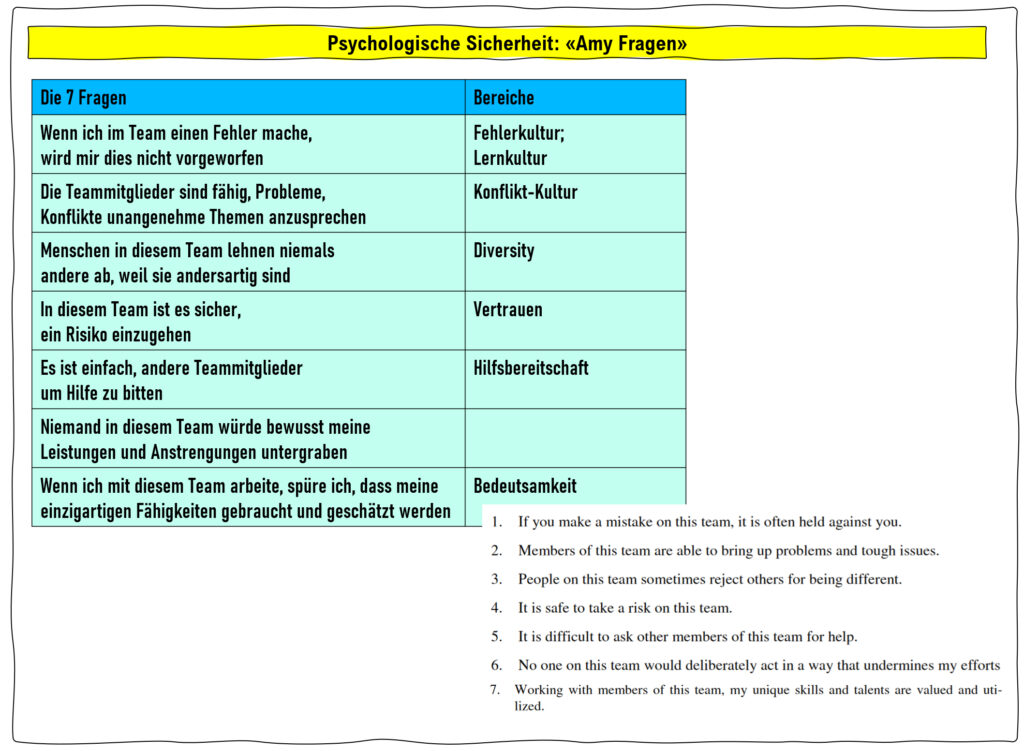
| Aspekte / Diskussionsgrundlagen |
| [] siehe auch: Basis-Verhalten |
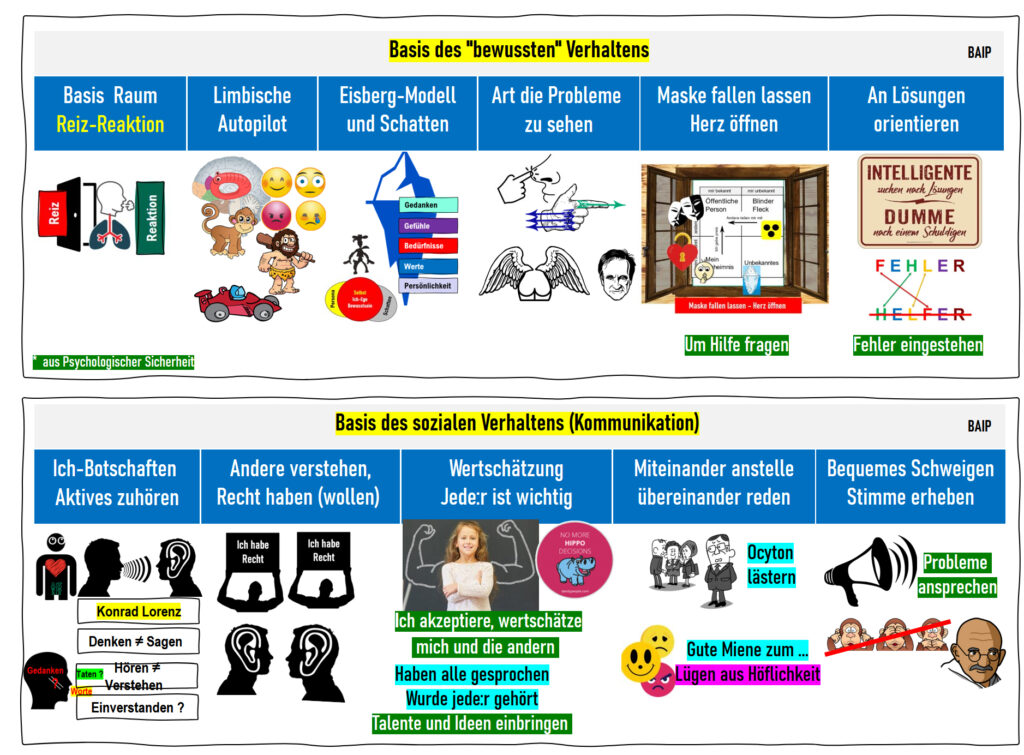
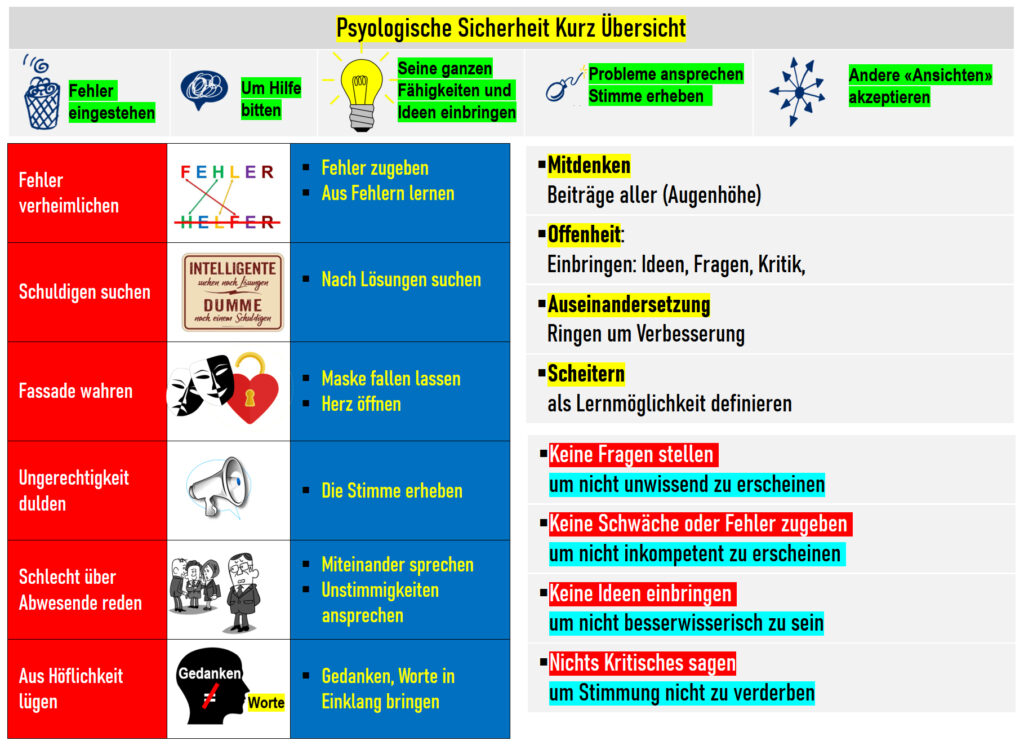


| Ergänzungen |
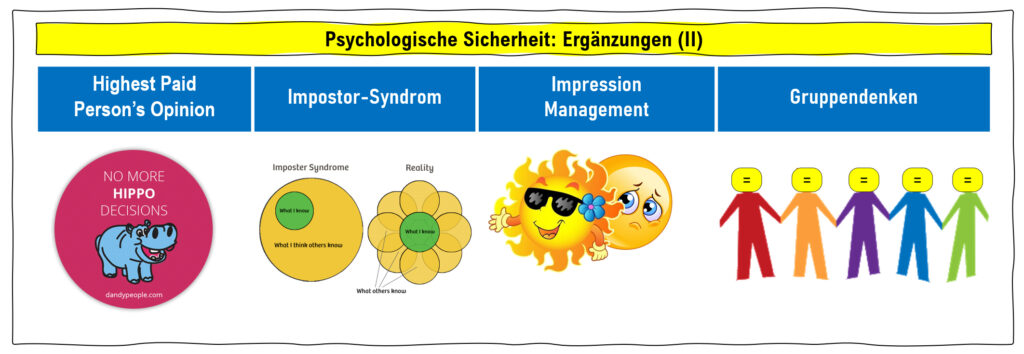
| Compact-Informationen / Inspiration |
| Weitere externe Informationen |
| [] Masterarbeit. Spezielles: [] Meine Link-Liste in Raindrop [] Blog-Beitrag Lars Richter [] Übungen Psych-saftety.org (sehr interessant) [] PsySafety-Fragebogen (deutsch) [] Arche – „Test-Spiel“ für Psychologische Sicherheit (Zusatz Info Marc Loeffler) [] Liberating Structures: (HSR, What I need from you) [] Artikel von Bettina Hoffmann und Dominik Hanisch |
| Vor Amy [] 1965 Edgar Schein / Warren Bennis (3 Ebenen der Kultur) [] 1972 Janis (Groupthinking) [] 1990 William Kahn |
| Amy Edmondson Studien und Bücher [] Studie 1999: Info in Englisch [] Buch: „The fearless Organinsation“ „Die Angsfreie Organisation“ [] Video: TED Talk |
| Google Studie (Aristoteles) [] Info Englisch: Englisch: 5-Key Doc-Team Effectiveness YouTube-Kanal [] Info Deutsch: Swiss-ICT Swiss-ICT Bericht Targetter Video Targetter Süddeutsche 5-Faktoren |
| Bericht über Google-Studie in New York Times Magazin [] Info Englisch: in Englisch: [] Info Deutsch: |
| Basis-Informationen: [] der „Dreieck-Kreis“: Blog-Artikel Futurebirds, Artikel im HR-Today [] die Vier-Zonen: Info skillsgarden.ch Thema Lernen [] die Fünf Schlüssel: Artikel in Pharmapro.ch, Artikel Charlotteheidsiek.com |
| Videos, Blog-Post [] Ina Goller: Video; Buch [] Julia Schormlemmer: Video [] Bettina Hoffmann & Dominik Hanisch: Offener Artikel in SpringLink [] Swiss ICT: Teil-1 Teil-2 [] Gerlad Peterson: Blog-Post [] Meyer, Wrba, Bachmann: Blog-Post [] Hansjörg Lusti: Wie lernen Organisationen-Folien |
| Ergänzungen [] |
| Podcast |

| Podcast [] Tania + Amy [] flowdays (1), (2), (3) [] Matthias [] Jasmine + Kai [] Sepideh [] Brille + Bart mit Joe |
Was ist das Geheimins der Psychologischen Sicherheit
Bei den Recherchen sind öfter, die folgende Fragen aufgetaucht: was ist das Geheimnis der Psychologischen Sicherheit und was wäre aus dem Thema Psychollogische Sicherheit geworden:
[] hätte Google nicht die Studie gemacht bzw.
[] hätte Charles Duhigg nicht im New York Time Magazin darüber berichtet?
Fehler und Konflikte gibt es in jedem Team
In allen Teams werden Fehler gemacht und entstehen Konflikte. Der entscheidende Faktor ist eher, wie das Team damit umgeht; werden Fehler verheimlicht und Konflikte unter den Teppich gekehrt oder wird offen darüber diskutiert, auch wenn es nicht immer angenehm ist.
Kritisch sein, eigenes Denken fördern
Die Recherche habe ich mit einer positiven, aber kritischen Einstellung durchgeführt. Dabei hat sich auch die Frage gestellt, ob Psychologische Sicherheit eine neue Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird oder nach altem Wein riecht, der in neue Schläuche abgefüllt wurde. (siehe auch)
Die schweigende Angst, der fehlende Mut – Psychologische Angst
Speziell sind die Situationen, wo Ungerechtigkeiten verschwiegen, geduldet oder sogar geleugnet werden, weil man Angst vor den Konsequenzen hat. Als „gutes“ Beispiel wird oft der VW-Abgas-Skandal erwähnt, wo die Mitarbeitenden die Haltung der drei Affen einnehmen, weil sie Angst haben, dass der Überbringer der schlechten Nachricht bestraft wird.
Unter dem Begriff „The Voice“ oder die „Stimme erheben“ lohnt es sich, sich zu fragen: „Habe ich geschwiegen, wo ich aufstehen sollte, um meine Stimme zu erheben.“
Lern-Impulse
Mein Ziel war weniger, alles über Psychologische Sicherheit zu erfahren, sondern eher Impulse zu generieren, um andere zum „Lernen“ zu inspirieren. Weitere Infos siehe hier.
| Veröffentlichte Impulse aus dem Buch: Psychologische Sicherheit von Birgit Schumacher |
| Wie werden Teams mutig und innovativ? Durch Vertrauen. Es ist die Basis für psychologische Sicherheit. Unsere Autorin Birgit Schumacher illustriert die neurobiologischen Mechanismen hinter der psychologischen Sicherheit. Denn ihr Verständnis ist essenziell, wenn wir ein Umfeld psychologischer Sicherheit schaffen wollen. Unser Nervensystem ist so aufgebaut, dass es über Rezeptoren ununterbrochen und ganz automatisch die Umgebung nach Gefahren absucht. Es will damit unser Überleben schützen. Das Buch zum Thema » Mehr Infos Heute ist es weniger der Säbelzahntiger, der um die Ecke kommt und unser Leben bedroht. Im einundzwanzigsten Jahrhundert kann es viel mehr ein Auto sein, das aus einer Seitenstraße geschossen kommt. Nicht so unmittelbar wie das Auto, aber genauso bedrohlich kann eine Gruppe von Menschen auf mich wirken, mit denen ich zusammenarbeiten soll, bei denen ich mir aber nicht sicher bin, ob sie mich mit meiner Art akzeptieren. Die Gefahr, abgelehnt zu werden, wirkt heute wie gestern als starke Bedrohung auf uns. Das bedeutet, dass wir ständig unser Außen bewerten und darauf in Millisekunden reagieren. Dabei ist es egal, ob das, was wir sehen, wirklich eine Tatsache ist oder nur eine Vorstellung in unserem Kopf. Um es an einem Beispiel zu veranschaulichen: Wenn du im Wald spazieren gehst und meinst, einen Bären zu sehen, wird automatisch dein autonomes Nervensystem anspringen und dein Körper wird entsprechend reagieren. Du wirst merken, wie dein Puls schneller geht. Vielleicht wirst du förmlich vor Angst erstarren oder du wirst schneller, als du je gelaufen bist, vor dem Bären davonrennen. Völlig unabhängig davon, ob der Bär wirklich dort steht oder ob es eine Sinnestäuschung war. Entscheidend bei der Reaktion ist deine Bewertung der äußeren Situation. Neurobiologisch könnte man es wie folgt beschreiben: Zwischen deinem Außen und dem, was du daraus machst, wie du es interpretierst, ist eine Art Filter eingebaut. Dieser Filter nimmt alle Informationen aus der Umgebung auf und sammelt sie. Sicherheit entsteht dann, wenn dieser Filter das Ergebnis ableitet, dass keine Gefahr droht oder besteht. Der Filter setzt sich aus vier Ebenen der Wahrnehmung zusammen: Exterozeption: die Fähigkeit, die Umwelt wahrzunehmen. Interozeption: die Fähigkeit, die Innenwelt wahrzunehmen. Propriozeption: die Fähigkeit, die Lage des Körpers im Raum wahrzunehmen. Neurozeption: die Gesamtheit von Innen und Außen. Wie sensibel unser System reagiert, wird maßgeblich davon beeinflusst, was wir im Laufe unseres Lebens über Gefahr und Sicherheit gelernt haben. Insbesondere, wie viel Stress wir in unserer Kindheit und Jugend erlebt haben. Deshalb sollten wir uns oder andere Menschen auch nicht abwerten, wenn wir ängstlich oder unsicher sind. Was für den einen noch sicher ist, fühlt sich für den anderen unsicher an. Und beides ist im Sinne der jeweiligen Neurozeption wahr und richtig. Sicherheit ist ein subjektives Erleben Die Interozeption, Exterozeption und Neurozeption eines Menschen entwickeln sich bereits im Mutterleib und sie bilden sich im Laufe der Kindheit weiter aus. Wie oben beschrieben hilft uns unser Frühwarnsystem, zu erkennen, wann etwas gefährlich ist und wann nicht. Dafür muss dieses System mit Informationen darüber versorgt werden, was sicher, was bedrohlich und was lebensbedrohlich ist. Dies geschieht im Kindesalter. Hier schon wird unser Frühwarnsystem programmiert. Durch eigene Erfahrung und die – im besten Fall – gute Begleitung der verantwortlichen Erwachsenen oder durch das Abgucken des Verhaltens bei ebendiesen. Um es noch etwas konkreter zu machen: Kinder, die in einem bedrohlichen Umfeld aufwachsen, entwickeln eine Exterozeption, die angespannt und übersteuert ist. Die Exterozeption von Kindern, die in einem sicheren Umfeld aufwachsen, reagiert hingegen entspannt aufmerksam. Es gibt also Menschen, die überall Gefahren sehen und den Teufel an die Wand malen, und Menschen, die entspannter mit dem umgehen können, was sie im Außen vorfinden. Sie entscheiden sich dabei nicht aktiv für ihre Bewertung, es ist ein automatischer Prozess, der in ihrem Innern abläuft. Diesen Prozess kann man jedoch beeinflussen und daran arbeiten – dazu wirst du im zweiten und im letzten Kapitel mehr Informationen finden. |
| »Psychologische Sicherheit ist immer ein subjektives Empfinden.« Eine Interozeption, die die inneren Wahrnehmungen schnell als bedrohlich einstuft, entsteht, wenn Kinder früh mit körperlichem Schmerz oder einer Krankheit konfrontiert werden. Hier werden körperliche Symptome früh und stark wahrgenommen. Dadurch können Ängste entstehen, die das weitere Verhalten bestimmen. Wenn Kinder die Welt als gefährlichen und lieblosen Ort kennenlernen mussten, wenig körperliche Berührung bekamen oder Bezugspersonen ausgesetzt waren, die ein schädigendes Verhalten auf das Kind hatten, entwickelt sich daraus eine Neurozeption, die beständig Gefahr meldet. Bis hierhin lassen sich zwei Schlussfolgerungen ziehen, die für das weitere Verständnis wichtig sind: Die Basis für das, was wir grundsätzlich als sicher empfinden, basiert auf den Erfahrungen unserer frühen Kindheit. Da wir immer auf der Suche nach Sicherheit sind, ist unser Verhalten darauf ausgerichtet. Wir machen nichts, was für uns gefährlich sein könnte. Diese Zusammenhänge erklären, weshalb verschiedene Menschen sich in ein und derselben Situation unterschiedlich sicher fühlen oder warum bestimmte Menschen mit Veränderungen besser klarkommen als andere. Das gilt auch und gerade für das Verhalten in Beruf und Arbeitsleben. Woran kann man das Gefühl von Sicherheit messen? Der Zustand von Sicherheit und Unsicherheit ist neurobiologisch abbildbar. Dafür hat der amerikanische Psychologe und Achtsamkeitsforscher Daniel Siegel das Stresstoleranzfenster beschrieben (»Window of tolerance«). Es dient als Modell für die einfache Veranschaulichung unseres Nervensystems: Es meldet uns entweder Sicherheit oder Gefahr. Wir erinnern uns: Ein Mangel an (empfundener) Sicherheit führt zu Stress. Die Stressreaktionen geben uns Auskunft darüber, wo wir uns in unserem Toleranzfenster aufhalten.  Es gib drei Bereiche des Erregungsniveaus: Den Bereich des optimalen Erregungsniveaus: dort, wo wir uns sicher fühlen. Den Bereich der Übererregung unter Unsicherheit. In diesem Zustand ist unsere Wahrnehmung stark geweitet. Wir stehen unter Anspannung, sind gestresst und nehmen unser Außen als bedrohlich wahr. Unsere Exterozeption steht förmlich unter Feuer. Beispielhafte Symptome der Übererregung können sein: innere Unruhe, Konzentrationsschwierigkeiten, körperliche Unruhe, Schlaflosigkeit, Gedankenkarussell, Reizbarkeit, Wut. Den Bereich der Untererregung unter Unsicherheit: Wir nehmen weniger von unserem Außen wahr. Auch die Interozeption ist abgeschwächt. Symptome der Untererregung können sein: wenig Ausdruck in Mimik und Gestik, leere im Kopf, Verlust von Konzept und Zusammenhang, Schwierigkeiten, Entscheidungen und Planungen umzusetzen, Rückzug, Vermeidung sozialer Kontakte, Gleichgültigkeit, Verlust von Motivation. Wenn wir also ein Umfeld psychologischer Sicherheit erschaffen wollen, ist es wichtig, diesen Zusammenhang bewusst vor Augen zu haben. Das umgebende System sollte so sicher sein, dass jeder innerhalb seines Stresstoleranzfensters agieren kann – unabhängig davon, wie weit es ausgeprägt ist. Wir sollten immer die Erwartung haben, dass Menschen sehr unterschiedliche Sicherheitsbedürfnisse haben und sich unterschiedlich verhalten. Ein solches für eine Gruppe von Menschen passendes Umfeld können wir nicht allein erzeugen, es ist eine Aufgabe, die besser gemeinsam mit dem Team angegangen werden sollte. Führende sollten nicht in die Falle laufen, dass sie sich allein für die Herstellung psychologischer Sicherheit verantwortlich fühlen. Und wie schaffen wir ein pschologisch sicheres Umfeld? Wir haben bis hierhin gelernt, was mit uns passiert, wenn wir uns nicht sicher fühlen. Das heißt, wie und wann unser Nervensystem Gefahr meldet. Gefahren waren früher ein Säbelzahntiger, heute wird eine Konfliktsituation als existenzielle Bedrohung durch das Unbewusste gewertet. Beides versetzt unseren Körper in eine erhöhte Aufmerksamkeitsspanne. Wir werden dann stark von dem, was in unserem Außen passiert, gesteuert. Eigentlich reagieren wir nur noch auf das, was passiert, anstatt einen kühlen Kopf zu bewahren, sehr bewusste Entscheidungen zu treffen und in einen proaktiven Modus zu schalten. Aber was braucht es, um sagen zu können, dass es sich um ein Umfeld handelt, in dem sich alle sicher fühlen können? Ein Umfeld, in dem das Nervensystem entspannen kann und wir unsere Energie und unseren Fokus auf die Themen legen können, an denen wir arbeiten, und nicht darauf, Gefahr abwenden zu müssen. Dazu dürfen wir uns wieder unserer Natur zuwenden: Wir sind soziale Wesen, wir benötigen die Verbindung zu anderen, das ist unsere genetische Programmierung. Das heißt, wenn wir uns mit den Menschen, mit denen wir leben oder arbeiten, verbunden fühlen, gibt uns das ein Gefühl von Sicherheit. Neurobiologisch ausgedrückt: wenn der ventrale Vagus im Positiven wirken kann. Dies geschieht, wenn folgende fünf Punkte erfüllt sind: Anerkennung: Unsere Leistung soll wertgeschätzt werden. Interesse: Wir wollen als Mensch gesehen werden. Respekt: Unsere Bedürfnisse und Gefühle sollen geachtet werden. Wohlwollen: Der Blick auf unsere Stärken und das Vertrauen darein, dass wir in positiver Absicht handeln, geben uns Sicherheit. Selbstbestimmung: Wir benötigen Wahlmöglichkeiten. |
| Gute Konflikte wirken wie ein Sommerregen. Ein Sommerregen lässt einen danach besser durchatmen. Gerade dann, wenn man in der Stadt wohnt. Die Luft ist wieder klarer und frischer. In einer guten Beziehung – in der beide Menschen sich gemeinsam weiterentwickeln wollen – ist ein gelegentlicher Streit so wichtig wie ein Sommerregen. Mit Tina (meiner Frau) habe ich mich von Beginn unserer Beziehung an gestritten. Allerdings haben unsere damaligen Streitereien keinen Effekt von Sommerregen gehabt 😆 Das mit den Sommerregen-Streits mussten wir erst lernen und glaube mir, wir sind dafür durch eine harte Schule gegangen. Unsere Konflikte sind nun ehrlicher und weniger verletzend. Das letzte Mal, als wir uns gestritten haben, habe ich mich über etwas sehr aufgeregt (typisch für mich). Tina fand meine Art dabei einengend und fühlte sich in die Ecke gedrängt. Ich habe mir im Nachgang mal angeschaut, was wir gemacht haben, um aus dem Konflikt einen Sommerregen zu machen. So kann man einen Streit gut beenden 👇🏼 🧠 Schweigen ist Silber, Reden ist Gold – aber erst, wenn sich die Nervensysteme beruhigt haben: Wir können keine Veränderungen herbeiführen, wenn die Anspannung hoch ist. Eine sinnvolle und nachhaltige Veränderung ist nur möglich, wenn beide Seiten mit einem beruhigten Nervensystem arbeiten. Und da kommt das Thema Psychologische Sicherheit ins Spiel: Wenn wir im Streit sind, ist unser Nervensystem im Kampf/Flucht/Totstell-Modus. Und so lange das so ist, werden wir es nicht schaffen, so miteinander zu reden, dass wir einander zuhören und den anderen verstehen wollen. Was du also tun kannst, damit das Gespräch ein Gutes wird👇🏼 1️⃣ Sind beide Gemüter abgekühlt? Wenn du merkst, dass du wieder innerhalb deines Stresstoleranzfensters angekommen bist (👉 du kannst wieder an etwas anderes denken als an den Streit und feuerst gedanklich nicht weiter gegen deinen Partner), frag dein Gegenüber, ob er oder sie jetzt bereit ist, zu reden. 2️⃣ Verständnis herstellen Damit eine Beziehung weiterhin erfüllend und zufriedenstellend bleibt, müssen wir einander verstehen und unsere Bedürfnisse und Gefühle miteinander teilen. In dieser Phase geht es darum, dass wir ehrlich zueinander sind und alles auf den Tisch legen. Jeder sollte dem anderen erzählen, wie er sich in der Situation gefühlt hat. Die Reaktion auf das Gesagte sollte dann keine Verteidigung oder Rechtfertigung sein, sondern weitere Fragen, um zu verstehen, um was es dem Partner wirklich geht. Das können Fragen sein wie: 👉 „Was muss ich verstehen, was ich noch nicht zu verstehen scheine?“ 👉 „Was an deiner Erfahrung übersehe oder ignoriere ich?“ 3️⃣ Was soll ich Deiner Meinung nach ändern? Ich frage: „Wenn du mir sagen könntest, dass ich etwas anders machen soll und es ist zu 100 % garantiert, dass ich diese Änderung vornehme, was würdest du mir sagen, was ich tun soll?“ Wenn ich das dann höre, prüfe ich mich selbst: „Stimmt die von ihr geforderte Verhaltensänderung mit dem überein, was ich sein möchte?“ Wenn ja, dann übernehme ich die Verantwortung. Das klingt wie: „Ja, so möchte ich sein, so möchte ich mich dir gegenüber verhalten und das habe ich bisher nicht.“ Und ich verpflichte mich, es umzusetzen. Wenn es mehr oder weniger mit dem übereinstimmt, was ich sein möchte, es aber nicht ganz trifft, sage ich: „Das gefällt mir an dem, was du von mir willst, aber diese anderen Teile gefallen mir nicht.“ 4️⃣ In die Umsetzung kommen Jetzt wissen wir beide, an welchen Stellen wir unser Verhalten zukünftig verändern sollten. Bleibt offen, wie wir einander auf diesem Weg unterstützen können. Fragen dazu können sein: 👉 „Was kann ich anders machen, um die von dir gewünschten Veränderungen zu unterstützen?“ 👉 „Ich möchte, dass du mir hilfst, so zu sein, wie wir beide es wollen.“ Dann machen wir uns als Einzelne und als Partner für die Umsetzung verantwortlich. Zum guten Schluss: Beziehungen scheitern in meinen Augen nicht daran, dass die Liebe verloren geht. Die Nähe ist verloren gegangen. Und Nähe geht durch ungelöste Konflikte verloren. Streitigkeiten gut zu beenden, ist also überlebenswichtig, um eine liebevolle Beziehung zu führen. |
| Die Neurobiologie hinter der psychologischen Sicherheit Um Teams oder einzelne Menschen bestmöglich dabei begleiten zu können, in ihre psychologische Sicherheit zu kommen, ist es wichtig, die Symptome von Unsicherheit zu kennen und sie auch in unserem Gegenüber und in uns selbst wahrnehmen zu können. Dabei hilft uns sehr, das Nervensystem in den Blick zu nehmen und mithilfe des sogenannten Stresstoleranzfensters zu verorten, wo sich ein Mensch gerade befindet. Der Zustand der psychologischen Sicherheit ist komplex und von vielen Faktoren abhängig, nicht nur dem Außen. Um diesen Zustand ausreichend erfassen zu können und das Gefühl von Sicherheit greifbarer zu machen, ist es wichtig zu verstehen, was neurobiologisch in uns abläuft, wenn wir uns sicher oder unsicher fühlen. Es geht also auch darum, die autonomen Zustände des Nervensystems erkennen und unterscheiden zu können. Wir schulen unseren Blick – was durch das Hintergrundwissen möglich wird – dafür, Angst und deren Stressreaktionen zu erkennen und auch die latenten und subtileren Zustände nicht zu übersehen. Dadurch wird es uns möglich, passende Angebote für den gegenwärtigen Moment zu machen. Das ist der Grund, warum ich in den nächsten Kapiteln in die Tiefe unseres Nervensystems und unseres Gehirns einsteige. Ich erläutere die Neurobiologie von Angst und Stress. Wie entsteht Angst, woran zeigt sie sich neurobiologisch, was passiert in unserem Körper und wie können wir neurobiologisch wieder in einen Zustand von Sicherheit kommen? Es kann sein, dass du an der ein oder anderen Stelle beim Lesen in die Innenschau gehen wirst und eine Art Selbst-Check machst. Das ist gut und von mir auch so angedacht. Denn nur eine Person, die sich ihrer selbst bewusst und darüber selbstsicher ist, kann ein Umfeld entstehen lassen, in dem Menschen sicher arbeiten und leben können. |
| Die Suche nach der Sicherheit im Außen Unser Nervensystem ist so aufgebaut, dass es über Rezeptoren ununterbrochen und ganz automatisch die Umgebung nach Gefahren absucht. Es will damit unser Überleben schützen. Heute ist es weniger der Säbelzahntiger, der um die Ecke kommt und unser Leben bedroht. Im einundzwanzigsten Jahrhundert kann es viel mehr ein Auto sein, das aus einer Seitenstraße geschossen kommt. Nicht so unmittelbar wie das Auto, aber genauso bedrohlich kann eine Gruppe von Menschen auf mich wirken, mit denen ich zusammenarbeiten soll, bei denen ich mir aber nicht sicher bin, ob sie mich mit meiner Art akzeptieren. Die Gefahr, abgelehnt zu werden, wirkt heute wie gestern als starke Bedrohung auf uns. Das bedeutet, dass wir ständig unser Außen bewerten und darauf in Millisekunden reagieren. Dabei ist es egal, ob das, was wir sehen, wirklich eine Tatsache ist oder nur eine Vorstellung in unserem Kopf. Um es an einem Beispiel zu veranschaulichen: Wenn du im Wald spazieren gehst und meinst, einen Bären zu sehen, wird automatisch dein autonomes Nervensystem anspringen und dein Körper wird entsprechend reagieren. Du wirst merken, wie dein Puls schneller geht. Vielleicht wirst du förmlich vor Angst erstarren oder du wirst schneller, als du je gelaufen bist, vor dem Bären davonrennen. Völlig unabhängig davon, ob der Bär wirklich dort steht oder ob es eine Sinnestäuschung war. Entscheidend bei der Reaktion ist deine Bewertung der äußeren Situation. Neurobiologisch könnte man es wie folgt beschreiben: Zwischen deinem Außen und dem, was du daraus machst, wie du es interpretierst, ist eine Art Filter eingebaut. Dieser Filter nimmt alle Informationen aus der Umgebung auf und sammelt sie. Sicherheit entsteht dann, wenn dieser Filter das Ergebnis ableitet, dass keine Gefahr droht oder besteht. Der Filter setzt sich aus vier Ebenen der Wahrnehmung zusammen: Exterozeption: die Fähigkeit, die Umwelt wahrzunehmen. Interozeption: die Fähigkeit, die Innenwelt wahrzunehmen. Propriozeption: die Fähigkeit, die Lage des Körpers im Raum wahrzunehmen. Neurozeption: die Gesamtheit von Innen und Außen. Exterozeption Wir nehmen unsere Umgebung über unsere Sinne wahr. Wir schmecken, hören, riechen, sehen und fühlen. Darüber werden wir mit Informationen versorgt. Unbewusst und permanent bewerten wir darüber die Situation oder die Umgebung, in der wir uns befinden. Auch komplexe Wahrnehmungen wie die der Stimmung zwischen Menschen oder der Atmosphäre einer Situation gehören dazu. Du kennst sicherlich das Gefühl, wenn du in einen Raum kommst, in dem vorher gestritten wurde. Du spürst sofort, dass hier etwas nicht stimmt. Die Wahrnehmung des Außen ist ein Teil unseres inneren Sicherheitssystems und eine wichtige Fähigkeit, um einschätzen zu können, wie sicher wir uns fühlen können. Interozeption Die Interozeption ist die Wahrnehmung unserer Innenwelt, also die Wahrnehmung unseres Körpers und seines Zustandes. Hunger und Durst sind beispielsweise Teil der Interozeption. Auch wenn wir Halsschmerzen bekommen und uns matt und kränklich fühlen, ist das ein Signal unseres inneren Sicherheitssystems, das uns meldet: »Achtung, schone dich besser.« Propriozeption Um die Liste zu vervollständigen, sei hier auch die Propriozeption genannt. Sie bezeichnet die Wahrnehmung des eigenen Körpers nach dessen Lage im Raum. Für unser Thema wird dies nicht weiter relevant sein. Neurozeption Intero- und Exterozeption sind in einem ständigen Wechselspiel. Sie hängen miteinander zusammen und werden in dieser Verbundenheit Neurozeption genannt. Du kannst dir das in etwa so vorstellen wie die Sicherheitssysteme in deinem Auto. Sie sind aufeinander abgestimmt, laufen im Hintergrund mit, ohne etwas dafür tun zu müssen. Dieses Frühwarnsystem wertet kontinuierlich die komplexen neurobiologischen Abläufe im Innern aus und es meldet uns, wenn wir in Gefahr sind. Es sichert damit unser Überleben. Wie sensibel unser System reagiert, wird maßgeblich davon beeinflusst, was wir im Laufe unseres Lebens über Gefahr und Sicherheit gelernt haben. Insbesondere, wie viel Stress wir in unserer Kindheit und Jugend erlebt haben. Deshalb sollten wir uns oder andere Menschen auch nicht abwerten, wenn wir ängstlich oder unsicher sind. Was für den einen noch sicher ist, fühlt sich für den anderen unsicher an. Und beides ist im Sinne der jeweiligen Neurozeption wahr und richtig. |
| 1.1.2 Sicherheit ist ein subjektives Erleben Die Interozeption, Exterozeption und Neurozeption eines Menschen entwickeln sich bereits im Mutterleib und sie bilden sich im Laufe der Kindheit weiter aus. Wie oben beschrieben hilft uns unser Frühwarnsystem, zu erkennen, wann etwas gefährlich ist und wann nicht. Dafür muss dieses System mit Informationen darüber versorgt werden, was sicher, was bedrohlich und was lebensbedrohlich ist. Dies geschieht im Kindesalter. Hier schon wird unser Frühwarnsystem programmiert. Durch eigene Erfahrung und die – im besten Fall – gute Begleitung der verantwortlichen Erwachsenen oder durch das Abgucken des Verhaltens bei ebendiesen. Um es noch etwas konkreter zu machen: Kinder, die in einem bedrohlichen Umfeld aufwachsen, entwickeln eine Exterozeption, die angespannt und übersteuert ist. Die Exterozeption von Kindern, die in einem sicheren Umfeld aufwachsen, reagiert hingegen entspannt aufmerksam. Es gibt also Menschen, die überall Gefahren sehen und den Teufel an die Wand malen, und Menschen, die entspannter mit dem umgehen können, was sie im Außen vorfinden. Sie entscheiden sich dabei nicht aktiv für ihre Bewertung, es ist ein automatischer Prozess, der in ihrem Innern abläuft. Diesen Prozess kann man jedoch beeinflussen und daran arbeiten – dazu wirst du im zweiten und im letzten Kapitel mehr Informationen finden. Eine Interozeption, die die inneren Wahrnehmungen schnell als bedrohlich einstuft, entsteht, wenn Kinder früh mit körperlichem Schmerz oder einer Krankheit konfrontiert werden. Hier werden körperliche Symptome früh und stark wahrgenommen. Dadurch können Ängste entstehen, die das weitere Verhalten bestimmen. Wenn Kinder die Welt als gefährlichen und lieblosen Ort kennenlernen mussten, wenig körperliche Berührung bekamen oder Bezugspersonen ausgesetzt waren, die ein schädigendes Verhalten auf das Kind hatten, entwickelt sich daraus eine Neurozeption, die beständig Gefahr meldet. »Psychologische Sicherheit ist immer ein subjektives Empfinden.« Bis hierhin lassen sich zwei Schlussfolgerungen ziehen, die für das weitere Verständnis wichtig sind: Die Basis für das, was wir grundsätzlich als sicher empfinden, basiert auf den Erfahrungen unserer frühen Kindheit. Da wir immer auf der Suche nach Sicherheit sind, ist unser Verhalten darauf ausgerichtet. Wir machen nichts, was für uns gefährlich sein könnte. Diese Zusammenhänge erklären, weshalb verschiedene Menschen sich in ein und derselben Situation unterschiedlich sicher fühlen oder warum bestimmte Menschen mit Veränderungen besser klarkommen als andere. Das gilt auch und gerade für das Verhalten in Beruf und Arbeitsleben. Dazu ein Beispiel aus meinem Coaching-Alltag: In meiner Rolle als Coach durfte ich ein Team begleiten, das ein großes Projekt stemmen sollte. Auf dem Projekt lag viel »Management-Attention« und damit lastete ein hoher Erfolgsdruck auf dem Team und der Projektleitung. Das Projekt musste in der vorhergesehenen Zeit und mit dem vorgegebenen Budgetrahmen zum Erfolg gebracht werden. Ein vorhergehender Projektleiter war bereits von dem Projekt abgezogen und durch einen neuen ersetzt worden. Es gab innerhalb des Projektteams eine Kollegin, die bezogen auf ihre fachliche Kompetenz sehr geschätzt und immer beratend hinzugezogen wurde. Sie war in ihren Aussagen klar, dabei aber auch persönlich abwertend, wenn Dinge nicht sofort verstanden oder so gemacht wurden, wie sie es sich vorgestellt hatte. Diese Art ihrer Kommunikation wurde toleriert, auch von den Führungskräften. Ein weiteres Teammitglied war Angelika. Ich nahm sie als eine sehr aufmerksame und schlaue Frau wahr. Sie bekam alles mit, auch die Schwingungen in- und außerhalb des Teams. In meinen Augen brachte sie alle Kompetenzen mit, die es brauchte, um aktiv dazu beitragen zu können, das Projekt zu einem Erfolg werden zu lassen. Und obwohl sie nicht nur kognitiv stark war, sondern auch hervorragende Antennen für die zwischenmenschlichen Töne hatte, traute sie sich nicht, nach vorn zu treten und Verantwortung zu übernehmen. Sie fühlte sich nur sicher in Besprechungskonstellationen, in denen auch ein Kollege dabei war, der für das Team sprach und die Entscheidungen traf. Mit der Zeit sprach sich das herum und man lud sie zu immer weniger Besprechungen ein. In der Folge bekam sie immer weniger Aufgaben und Verantwortung übertragen. Das frustrierte nicht nur sie, sondern auch das übrige Team. Ihr wurde zum Vorwurf gemacht, dass sie sich nicht traute, Themen allein zu klären und in die Auseinandersetzung mit anderen Unternehmensbereichen zu gehen. Über persönliche Gespräche bekam ich ein wenig Einblick in ihre Geschichte. Wirklich sicher hatte sie sich nie fühlen können. Sie hatte nie die Bestätigung bekommen, dass sie gut war, wie sie ist. Sie wuchs zunächst in einem strengen Elternhaus auf, wurde oft kritisiert und mit ihrem großen Bruder verglichen. Angelika hatte Angst davor, einen Fehler zu machen und dafür beschämt zu werden. Das offen zu kommunizieren traute sie sich in ihrem Arbeitsumfeld aber nicht, sie spürte, dass über sie gesprochen wurde. Angelikas Verhalten in dem Projekt war eine reine Schutzreaktion. Es lag nicht daran, dass sie unmotiviert war oder die Kollegen nicht mochte. Sie hatte einfach nur Angst. Angst vor einem dummen Spruch und Angst davor, in einer Gruppe abgewertet zu werden. Das Gefühl von Beschämung kannte sie noch zu gut aus ihrer Kindheit. Die Erlebnisse waren so schlimm für sie gewesen, dass sie alles dafür tat, es nicht mehr fühlen zu müssen. Bevor wir also das Verhalten von Menschen verurteilen, sollten wir uns immer die Frage stellen: »Wozu ist das für die Person gut? Wovor schützt es sie?« Denn wie wir gelernt haben, ist unser Nervensystem darauf programmiert, Gefahr abzuwehren. Negative Erlebnisse wie Abwertung, Ausschluss oder Abweisung können dabei genauso als Gefahr wahrgenommen werden wie ein Säbelzahntiger vor über zwanzig Millionen Jahren. Das macht für das Gehirn keinen Unterschied. In Gefahrensituationen gilt dann: Unser Verhalten wird wie zu Säbelzahntigerzeiten vom Stammhirn gesteuert. Verstand und Ratio ade. Die empfundene Sicherheit bestimmt also unser Verhalten. Sicherheit ist die Voraussetzung, um überhaupt gut arbeiten und offen für Neues sein zu können. Sie ist die Essenz dafür, dass wir das, was an Potenzial in uns steckt, überhaupt leben können. Diese Tatsache sollte immer berücksichtigt werden, wenn mit Menschen gearbeitet wird. Insbesondere dann, wenn man in einer Form für sie oder den gemeinsamen Prozess verantwortlich ist. Beispielsweise in der Rolle als Führungskraft oder Coach. |
| Info aus: https://blog.wiwo.de/management/2023/12/12/buchauszug-birgit-schumacher-psychologische-sicherheit-das-entwicklungselixier-fuer-persoenliches-wachstum-teams-und-organisationen-2/ Kennzeichen einer unsicheren Gesellschaft Schaut man sich in seinem Bekannten- und Freundeskreis um, sieht man überall ähnliche Bilder: gestresste Menschen. Familien mit Kleinkindern oder mit pflegebedürftigen Angehörigen scheint es noch einmal härter zu treffen. Es handelt sich dabei aber nicht nur um eine subjektive Wahrnehmung, denn auch die Zahlen belegen es (Badura et al. 2022). Begriffe wie Depressionen, Angststörungen, Burn-out und Überforderung sind in aller Munde. Die Nervensysteme der betroffenen Menschen liegen dauerhaft außerhalb ihres Stresstoleranzfensters und die Menschen haben keine Werkzeuge, um sich selbst zu regulieren. Was sich hier zeigt, ist eine Leistungsgesellschaft, die aufgrund fehlender Gegenstrategien zunehmend zur Burn-out-Gesellschaft wird. Hier das Gesundheitssystem als Reparaturbetrieb zu missbrauchen, halte ich für falsch. Das heißt nicht, dass unsere gesellschaftliche Entwicklung rückgängig gemacht werden sollte, aber wir müssen nach Möglichkeiten suchen, um modernes Leben und Gesundheit dauerhaft miteinander zu vereinbaren. Neid als Folge von Angst und transgenerationalen Traumatisierungen Wenn es eine Angst ist, die sich immer wieder zeigt, dann ist es wohl die Existenzangst. Ich habe Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen und mit unterschiedlichen Einkommen und vermeintlichen Sicherheiten über ihre Existenzangst in meinen Coachings klagen gehört. Die Worst-case-Szenarien, die dabei beschrieben werden, haben mich in ihrer Kreativität häufig überrascht. Existenzangst ist oft so stabil, dass sie selbst in sorglosen Zeiten im Hintergrund lauert und nur darauf wartet, dass es einen unsicheren Moment gibt und sie zuschlagen kann. Sie kann aber auch sehr subtil wirken, sodass man sie bewusst gar nicht wahrnimmt. Dabei beeinflusst sie beispielsweise unsere Risikobereitschaft und deckelt unsere Veränderungswünsche. Existenzangst kann uns den Schlaf rauben und ein Nährboden für viele andere Ängste sowie für Depressionen sein. Für jede Angst gibt es Gründe, die dahinterstehen. So ist es auch bei der Existenzangst. Ich möchte hier auf die zwei meiner Meinung nach essenziellen Ursachen eingehen. Zum einen ist das die transgenerational überlieferte Traumatisierung und zum anderen ist es die Erfahrung der erlernten Hilflosigkeit. Unsere Eltern- und Großeltern-Generation sind im Krieg oder in der Nachkriegszeit aufgewachsen. Eine Zeit, in der alle Menschen traumatisiert wurden und ihre Existenz bedroht oder sogar vernichtet worden war. Unsere Familien tragen eine Traumatisierung in ihrem System, die sich ganz konkret und klar auf Existenz bezieht. Viele unserer Vorfahren, die vielleicht sogar noch leben, haben unmittelbar die Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn die eigene Existenzgrundlage entzogen wird und man mit leeren Händen, mit Hunger und mit der Bedrohung der puren Existenz konfrontiert ist. Als neurosystemisch und traumasensibel ausgebildeter Coach weiß ich, dass solche Traumatisierungen nicht mit der nächsten Generation einfach enden, sondern dass viele von diesen Traumatisierungen oftmals sehr subtil, teilweise aber auch direkt und greifbar weitergegeben werden. So sind in vielen Eltern oder Großeltern tiefe Ängste wirksam. Da ist kein Gefühl von wirklicher Sicherheit. Im Gegenteil, es gibt das Empfinden aufgrund einer tief sitzenden Prägung, dass das Hier und Jetzt nicht sicher ist und dass jederzeit etwas passieren kann. Dadurch entsteht oft ein übermäßiges Kontrollbedürfnis oder das Gefühl, dass keinerlei Art von Sicherheit wirklich Gewissheit bringen kann, dass es gut weitergehen wird. Wenn deine Eltern oder Großeltern diese Prägung erfahren haben, dann werden sie wahrscheinlich unwillkürlich etwas davon an dich weitergegeben haben. Möglicherweise werden sie dir ein Grundgefühl oder sogar konkrete Werte mitgegeben haben, die in Verbindung zu deinem Gefühl von Sicherheit und mit der Fähigkeit, unbeschwert zu leben, zu tun haben. Beispielsweise können sie dir vorgelebt haben, dass man sparsam leben und immer auch die zukünftige finanzielle Situation im Auge haben sollte. Grundsätzlich ist es sicherlich vernünftig, finanziell vorzusorgen. Wenn es aber dazu führt, dass du das Hier und Jetzt nicht genießt, du dir kaum etwas im Leben gönnst oder in deinem Nine-to-five-Job bleibst, der dich unglücklich macht, dann wirken diese Verhaltensweisen dysfunktional auf deine Lebensfreude. Diese Prägungen von Bedrohung und Mangel spiegeln sich auch in unserer heutigen Gesellschaft wider, in der wir auf Leistung getrimmt sind. Die Angst, dass jemand anderes einem etwas wegnehmen könnte, ist schnell auszulösen. Die Auswirkungen haben wir in der Flüchtlingskrise in den Jahren 2015 und 2016 gesehen, in der Schutzsuchenden nicht einmal ein Smartphone zugestanden wurde. Und auch im Jahr 2023 werden eigene Ängste mit Abwertung, Neid und Missgunst gegenüber Minderheiten und Ausländern kompensiert. Die erlernte Hilflosigkeit als Ursache vieler Ängste Die Ebene der weitergegebenen Traumatisierungen spiegelt sich auch in der zweiten Ursache für Existenzangst wider, die ich jetzt beleuchten werde. Das ist der Umstand der erlernten Hilflosigkeit. Dieser Begriff beschreibt genau, was er auch ist: das Erlernen von Hilflosigkeit. Hilflosigkeit erlernen wir, wenn unsere Bindungspersonen in unserer Kindheit nicht in der Lage sind, uns zu vermitteln, dass wir Dinge selbst bewältigen und dass wir unsere Bedürfnisse erfüllen können. Wenn in dem Alter, in dem wir unser Selbstbewusstsein entwickeln und unsere Selbstwirksamkeit erfahren, uns keine Gelegenheiten geschenkt werden, unsere eigene Kraft und Wirksamkeit zu erfahren, hat das Auswirkungen auf unser späteres Gefühl von Sicherheit. Erlernte Hilflosigkeit entsteht vielfach in Elternhäusern, in denen die Elternteile zum Beispiel durch Krieg traumatisiert wurden und dadurch ein erhöhtes Kontrollbedürfnis haben. Oder in Elternhäusern, in denen die Bindungspersonen aufgrund ihrer eigenen Traumatisierung ihren Kindern zu wenig Fürsorge geben können. Erlernte Hilflosigkeit entsteht demnach in den zwei extremen Polen: entweder dort, wo zu viel Kontrolle und dadurch keine Selbstwirksamkeit stattfinden konnte, oder dort, wo es zu wenig Hinwendung gab und dadurch Gefühle von Ohnmacht und Hilflosigkeit entstanden sind. Das, was dabei herauskommt, ist ein Gefühl von Unzulänglichkeit. Ein Gefühl, eigene Bedürfnisse nicht befriedigen oder versorgen zu können. Sich selbst nicht helfen zu können, im eigenen Leben machtlos und hilflos zu sein. Erlernte Hilflosigkeit stammt also aus einer Zeit, in der wir als Kinder abhängig von unseren Eltern waren. Die Existenzangst, die wir als Erwachsene fühlen, ähnelt dem Gefühl der erlernten Hilflosigkeit sehr. Denn auch in der Existenzangst fühlen wir uns abhängig von äußeren Umständen. Wir haben das Empfinden, dass unsere Sicherheit von äußeren Umständen bedroht sein könnte. Oder auch vom Gefühl der inneren Unzulänglichkeit. Eine Unzulänglichkeit, die der erlernten Hilflosigkeit entspricht, dem Mangel in das Vertrauen in die eigene Kraft und Selbstwirksamkeit. Existenzangst wird heutzutage meist bezeichnet als eine Angst vor finanzieller Unsicherheit und finanziellen Mangel. Wenn wir als Erwachsene Existenzangst haben, ist das also nichts anderes als uns von etwas abhängig zu fühlen, das uns unsere Existenz sichern kann. Heutzutage ist es das Geld – jedenfalls in unseren Breiten, in denen wir derzeit zum Glück nicht von Krieg bedroht sind. An anderen Orten dieser Welt ist Existenzangst wirklich das, was das Wort umschreibt, und das, was unsere Eltern und Großeltern erfahren haben: die blanke Angst ums Überleben. (Foto: Business Village/PR) Birgit Schumacher: „Psychologische Sicherheit – Das Entwicklungselixier für persönliches Wachstum, Teams und Organisationen“, Business Village Verlag, 29,95 Euro https://wwwPsychologische Sicherheit – Das Entwicklungselixier für persönliches Wachstum, Teams und Organisationen.businessvillage.de/psychologische-sicherheit.html »Existenzangst haben auch Millionäre, denn gegen die Angst hat die Ratio oft kaum eine Chance.« In dem Fall, den ich beschreibe, ist die Existenzangst in einem eigentlich sicheren Umfeld eine Facette von erlernter Hilflosigkeit. Meine Erfahrung zeigt, dass, wenn die erlernte Hilflosigkeit sich in Selbstwirksamkeit transformieren lässt, die Existenzangst an ihrer übermäßigen kraft- und raumgreifenden Qualität verliert. Sie lässt sich viel leichter eindämmen, wenn das Wissen und Fühlen der eigenen Kraft, die im eigenen Leben eine Wirkung hat, spürbar wird. Ein deutlicher Hinweis dafür, dass Existenzangst mit erlernter Hilflosigkeit zu tun hat, ist ihre vollkommene Losgelöstheit von Rationalität. Existenzangst ereilt sowohl den Millionär als auch den Arbeiter am Band, der fest angestellt ist und sein Gehalt erhält. Sie ereilt auch den Selbstständigen, der jeden Tag Kraft aufbringen muss, um Kunden zu gewinnen. Jede dieser Personen hat ihr eigenes Konzept von Bedrohung und ihr eigenes Konzept von Worst-case-Szenarien. Die gute Nachricht ist, dass es trotz dieser Vielfalt für jede Person einen Ansatz zur Lösung von Existenzangst gibt. Erlernte Hilflosigkeit zu transformieren ist ein Prozess, der nicht schnell geht, aber lohnenswert ist. Er ist so lohnenswert, weil er, wenn es gelingt, gelernte Hilflosigkeit zu transformieren, auch auf andere Ängste eine positive Wirkung hat. Man fühlt sich freier, selbstbestimmter und damit sicherer. In einer Gesellschaft, in der die Menschen sich in ihrer Selbstwirksamkeit spüren und nicht nur kognitiv wissen, dass sie selbstbestimmt handeln können, werden Phänomene wie Fremdenfeindlichkeit weniger zutage treten. Menschen, die sich nicht hilflos fühlen, benötigen keine Feindbilder mehr, um ihre Angst zu projizieren. Der Umgang mit gesellschaftlichen Ausnahmezuständen Die zentrale Frage ist, wie wir welche Rahmenbedingungen in unserer Gesellschaft setzen können, damit Menschen nicht aus ihrer Angst heraus agieren müssen. Zum einen sollte an die Ursache herangegangen werden, indem alles dafür getan wird, dass Kinder in einem Umfeld aufwachsen, in dem sie keine Ohnmacht und Hilflosigkeit erfahren müssen. Hier muss es mehr Aufklärung und Psychoedukation geben. Für Eltern und die Menschen, die unsere Kinder in Kitas und Schulen betreuen. Es braucht das Wissen über Bindungs- und Entwicklungstrauma und wie diese auf das Nervensystem von Kindern wirken. Auf der anderen Seite müssen Strukturen geschaffen werden, in denen Menschen psychologisch sicher leben und arbeiten können. Auf Arbeitsebene tragen hier, wie im vorherigen Kapitel aufgezeigt, Unternehmen eine führende Verantwortung. Gesellschaftlich sehe ich die Bildungs- und Gesundheitspolitik sowie die Medien in der Verpflichtung, ihren Teil dazu beizutragen. Die Kommunikation – auch der Medien – sollte in meinen Augen immer psychologisch sicher gestaltet werden. Äußere Umstände wie Pandemien und Kriege verunsichern die Menschen. Die Art und Weise, wie darüber berichtet wird, kann darauf einzahlen, ob diese Ängste verstärkt werden. Die Politik sollte aber daran interessiert sein, dass sich die Bürger innerhalb ihres Stresstoleranzfensters bewegen und darüber in Verbindung zu sich und ihren Mitmenschen bleiben können. So kann verhindert werden, dass unsichere Umstände dazu führen, dass Menschen in die autonomen Prozesse des Nervensystems fallen, die zu Flucht, Kampf und Immobilität führen. Wenn das Außen Angst macht, sollte alles dafür getan werden, dass die Menschen gestärkt werden und in Verbindung zueinander bleiben. In dieser Verbindung ist der ventrale Vagus aktiv, der zu einem Gefühl von innerer Sicherheit beiträgt. So kann der Neokortex, in dem unser rationales und bewusstes Denken stattfindet, weiterhin die Führung behalten, auch wenn das Außen unsicher ist. Aus einem selbstsicheren Zustand heraus kann man anderen Meinungen gegenüber offen bleiben. Eine Spaltung, wie wir es zu Pandemiezeiten erlebt haben, ist weniger wahrscheinlich. Nur in einem getriggerten Zustand erleben wir einen Kontrollverlust. Es handelt sich dabei aber nur um den Verlust unserer Impulskontrolle, der Verbindung zu unserem präfrontalen Cortex. Das Stammhirn dagegen behält die Kontrolle mithilfe unserer Überlebensreaktionen. Diese können sich in der Interaktion als gegenseitiges Anschreien (Kampf) oder Verstummen (Flucht) zeigen. In der Pandemie befanden wir uns alle in einer gefühlten Bedrohungssituation. Alle suchten auf ihre Art nach Sicherheit. Die einen fühlten sich hinsichtlich ihrer Gesundheit und ihres Lebens bedroht und die anderen hatten Angst um ihre Freiheiten. Jede der beiden Parteien hatte dabei den Anspruch, in ihrer Angst recht zu haben. Wenn in der eigenen Angst jemand anderes mit einer anderen Sichtweise daherkommt und uns zu vermitteln versucht, dass nur über diesen Weg Sicherheit entstehen kann, fühlt man sich zusätzlich bedroht. Flucht- und Kampfreaktionen werden aktiviert. Die Konsequenzen dieser Reaktion haben wir in den Nachrichten und Talkshows mitverfolgen können. Wir konnten bei den kontroversen Diskussionen, die in der Pandemie zu der Frage des richtigen Wegs geführt wurden, beobachten, dass diese oft impulsiv und emotional ausgetragen wurden. Betrachtet man soziale Interaktionen durch die Nervensystembrille, zeigt sich in emotionalen Aussagen, dass das limbische System aktiv ist. Werden Aussagen angreifend und aggressiv getroffen, ist der Agierende im Stammhirn-Modus unterwegs. Wenn wir Menschen und Dynamiken betrachten oder Dynamiken geschildert bekommen, ist es hilfreich zu schauen, wie viel Stressreaktion in dieser Dynamik steckt und wo sich die Menschen in ihrem Stresstoleranzfenster befinden. Mit diesem Wissen können wir aus der Distanz Hypothesen bilden und schauen, was es braucht, damit die Menschen wieder in das Gefühl von Sicherheit kommen. Mit dem Gefühl der Sicherheit kann die Verbindung zum präfrontalen Kortex wieder gelingen und der ventrale Vagus kann aktiv sein. Dies ermöglicht den Menschen, sich wieder sachlich – mit emotionalen Färbungen – zu unterhalten, ohne dass sie auf Bedrohungs- und Überlebensreaktionen ausweichen müssen. Die kollektive Situation der Pandemie mehr durch die Brille der neurobiologischen Stressreaktion zu betrachten, hätte zu weniger Urteilen und weniger Spaltungen geführt. Der Segen unseres präfrontalen Kortex und unseres damit verbundenen Bewusstseins ist, dass wir in unterschiedlichen Situationen die Klarheit behalten und in Verbindung bleiben können. Verbindung als Weg in die Sicherheit Wenn Menschen Angst haben, ist das beste Gegenmittel, um wieder Sicherheit zu spüren, die Verbindung. Das Gefühl, nicht allein zu sein, beruhigt unser Nervensystem. Sich mit anderen Menschen zu verbinden, war in der Pandemiezeit jedoch nicht oder nur eingeschränkt möglich. Über diesen Weg konnten wir uns nicht regulieren. Diese Tatsache hat viele Menschen besonders gestresst und verunsichert. Das heißt, zur Angst vor Krankheit kamen noch der Bindungsverlust und bei vielen Menschen ein Gefühl der Einsamkeit dazu. Dass Verbindung so essenziell und sogar ein bewährtes Gegenmittel gegen Drogensucht ist, zeigte der Psychologieprofessor Bruce Alexander in den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts. Man ging lange davon aus, dass eine Sucht durch die Suchtmittel entsteht, die man über einen gewissen Zeitraum einnimmt. Also dass Heroinsüchtige durch die Suchtmittel im Heroin süchtig werden. Das aktuelle Verständnis von Abhängigkeit beruht auf einer Reihe von Experimenten, die Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts durchgeführt wurden. Der Aufbau der Experimente ist einfach: Eine Ratte wird mit zwei Flaschen in einen Käfig gesteckt. In einer Flasche ist Leitungswasser, die andere wird mit Heroin oder Kokain versetzt. Viele Ratten entwickeln in diesem Experiment eine Sucht nach dem Drogenwasser und trinken es exzessiv, bis sie sich damit umbringen. Aber in den Siebzigerjahren fiel Bruce Alexander etwas an dem Experiment auf. Die Ratten werden einzeln in Käfige gesteckt. Sie haben nichts außer den Drogen. Was würde also passieren, wenn man die Sache anders angehen würde? Er baute daraufhin einen Rattenpark, der ein wahres Paradies für Ratten war. Die Ratten wohnten in einem liebevoll ausgestatteten Käfig mit bunten Bällen und Tunneln. Sie waren dort mit Freunden zusammen, mit denen sie spielen konnten. Außerdem bekamen sie Drogenwasser und Leitungswasser zur Auswahl. Sein Ergebnis war verblüffend. Die Ratten zeigten kaum Interesse am Drogenwasser. Keine von ihnen trank es zwanghaft oder starb an einer Überdosis. Es ist zwar nur ein einzelner Tierversuch, aber es gibt noch einige interessante Studien zum menschlichen Drogenkonsum in Extremsituationen (Hari 2017). Im Vietnamkrieg zum Beispiel konsumierten zwanzig Prozent der amerikanischen Soldaten regelmäßig Heroin. Es wurde befürchtet, dass die USA nach Ende des Krieges von Hunderttausenden Junkies überrannt werden würden. Aber eine Studie, die nach dem Krieg durchgeführt wurde, zeigte, dass die Soldaten weder in Kliniken landeten noch einen Entzug durchmachten. Fünfundneunzig Prozent hörten einfach auf, als sie nach Hause kamen. »Mit dem Gefühl, nicht allein ein Problem lösen zu müssen, ist das Problem schon halb gelöst.« Mit dem traditionellen Verständnis von Abhängigkeit allein kann man das nicht erklären. Mit Professor Alexanders Theorie kommt man der Sache jedoch näher: Befindet man sich in Gefahr und muss mit der Angst leben, zu sterben, dann ist Heroin eine verlockende Substanz, um diese Angst nicht spüren zu müssen. Kommt man aber nach Hause zu Familie und Freunden, ist es wie bei den Ratten und ihrer veränderten Umgebung. Es scheinen also nicht nur die Chemikalien eine Rolle zu spielen, sondern auch die Verbindungen, die Lebewesen benötigen. »Die alten Experimente waren also offenbar fehlerhaft. Nicht die Droge ist schuld am schädlichen Verhalten, sondern die Umgebung. Eine isolierte Ratte wird fast immer zum Junkie. Eine Ratte mit einem guten Leben dagegen so gut wie nie, auch wenn man ihr noch so viele Drogen bereitstellt.« Johann Haris Menschen haben ein angeborenes Bedürfnis, enge Beziehungen zu Mitmenschen aufzubauen. Als Baby und Kleinkind hat dies unser Überleben gesichert. Wenn es uns gut geht, fällt es uns leicht, in Verbindung zu gehen. Geht es uns jedoch schlecht, sind wir zum Beispiel traumatisiert oder isoliert, dann kann es passieren, dass wir eine enge Bindung zu einem Ersatzobjekt aufbauen. Dieses Ersatzprodukt kann für die einen das Handy sein, für andere ist es das Videospiel, Pornografie, Glücksspiel oder eben Kokain. In diesem Fall ist die Abhängigkeit von Ersatzbindungsprodukten ein Symptom der Traumatisierung und Isolation in unserer Gesellschaft. Der Ausweg daraus ist der Aufbau von engen, emotionalen Beziehungen zu anderen Menschen. Was aber tun wir mit Menschen, die drogenabhängig sind? Anstatt sie dabei zu unterstützen, sichere Verbindungen aufbauen zu können, werden sie von der Gesellschaft ausgestoßen. Wir bestrafen sie mit Leistungskürzungen und Gefängnis, wenn sie beim Drogenkonsum erwischt werden. Wir stecken sie in Zellen, also in Käfige, und sorgen dafür, dass Menschen, denen es nicht gut geht, sich noch schlechter fühlen. Wir verachten sie, wenn sie sich nicht bessern. Wir reden immer nur über die Besserung des Individuums und sehen nicht die Rolle der Gesellschaft in diesem Genesungsprozess, denn wir sind alle verantwortlich. Wir müssen vielmehr das Umfeld der betroffenen Menschen in Betracht ziehen und dürfen keine vorschnellen Urteile fällen. Anstatt Menschen in Schubladen zu stecken, sollten wir ihnen erst einmal zuhören. Der erste Schritt im Kampf gegen die Sucht sollte nicht harte Bestrafung, sondern Empathie sein. Die heutige Einsamkeitsepidemie und ihre Wirkung In den vergangenen Jahrzehnten ist das Gefühl von Einsamkeit für Millionen von Menschen chronisch geworden. In Großbritannien geben sechzig Prozent der Achtzehn- bis Vierunddreißigjährigen an, sich oft einsam zu fühlen (Orr 2014). In den USA fühlen sich sechsundvierzig Prozent der gesamten Bevölkerung regelmäßig allein (Cigna US 2019). Und in Deutschland sieht mehr als die Hälfte der Bevölkerung Einsamkeit als großes Problem (Tagesschau Deutschlandtrend 2018). Wir leben im Zeitalter der Vernetzung und doch fühlt sich ein riesiger Teil von uns isoliert. Einsam zu sein und allein zu sein ist nicht dasselbe. Man kann allein glücklich und zufrieden sein und sich in Gesellschaft von Freunden einsam und verlassen fühlen (WELT Gesundheit 2010). Einsamkeit ist subjektiv. Wenn du dich einsam fühlst, bist du einsam. Einsamkeit trifft nicht nur Menschen, die sozial wenig kompetent sind. Studien haben gezeigt, dass soziale Fähigkeiten kaum noch Einfluss auf soziale Kontakte haben. Einsamkeit macht vor niemandem halt, Geld, Macht, Schönheit, soziale Kompetenz, all das kann dich nicht vor Einsamkeit schützen. Einsamkeit wirkt wie das Gefühl von Hunger, bei dem dein Körper dir sagt, dass du etwas essen solltest. Einsamkeit macht dich auf deine sozialen Bedürfnisse aufmerksam. Diese Bedürfnisse sind für dich wichtig, denn sie haben vor Millionen von Jahren das Überleben gesichert. Zusammenarbeit und Vernetzung wurden mit einer höheren Überlebenswahrscheinlichkeit belohnt. Unsere Gehirne wurden immer empfänglicher für die Gedanken und Gefühle unserer Mitmenschen und für soziale Beziehungen. Unser soziales Wesen wurde Teil unserer Natur. Wir lebten in Gruppen von fünfzig bis einhundertfünfzig Menschen – und das meistens unser ganzes Leben lang (Dunbar/Sosis 2018: 106–111). Es war unmöglich, für ausreichend Essen, Sicherheit, Wärme und den Nachwuchs allein zu sorgen. Gemeinschaft bedeutete Überleben, Alleinsein den Tod. Es war also unerlässlich, sich mit den anderen gut zu verstehen. Für unsere Vorfahren war also nicht der Säbelzahntiger die größte Gefahr, sondern nicht in die Gruppe zu passen und verstoßen zu werden. Um das zu vermeiden, erfanden unsere Körper den sozialen Schmerz (Rodriguez 2019). Dieser Schmerz ist die Antwort der Evolution auf Zurückweisung. Ein Frühwarnsystem, das uns von isolierendem Verhalten abhalten sollte. Diejenigen unserer Vorfahren, die sich Zurückweisungen besonders zu Herzen nahmen, passten mit größerer Wahrscheinlichkeit ihr Verhalten an und wurden nicht von der Gruppe verstoßen, während andere ausgestoßen wurden und starben. Deshalb sind Zurückweisungen und vor allem Einsamkeit so schmerzhaft. Dieser Mechanismus hat für den größten Teil unserer Geschichte sehr gut funktioniert. Bis die Menschen sich eine ganz neue Welt aufgebaut haben. Die heutige Einsamkeitsepidemie nahm schon in der Renaissance ihren Anfang (Schiller 2006). Die westliche Kultur rückte das Individuum in den Mittelpunkt. Intellektuelle wandten sich vom Kollektivismus des Mittelalters ab. Die noch junge protestantische Theologie predigte die Verantwortlichkeit des Einzelnen. Die industrielle Revolution beschleunigte diesen Trend. Die Menschen verließen ihre Dörfer und Felder, um in Fabriken zu arbeiten. Städte wuchsen und mit der Industrialisierung beschleunigten sich diese Prozesse immer weiter. Heute ziehen wir für Jobs, die Liebe oder die Ausbildung an weit entfernte Orte und lassen unsere sozialen Kontakte zurück. Wir treffen uns mit weniger Menschen und auch seltener als früher. Chronische Einsamkeit entsteht meistens schleichend. Man wird erwachsen und hat neben Arbeit, Uni, Beziehung, Kindern und Fernsehen keine Zeit mehr für etwas anderes. Der effektivste Weg, dabei Zeit zu sparen, ist, Verabredungen abzusagen. Das geht so lange, bis man eines Tages aufwacht und sich isoliert fühlt. Plötzlich sehnt man sich nach engen Verbindungen. Aber als Erwachsener ist es schwieriger, Beziehungen aufzubauen. Dann kann Einsamkeit chronisch werden. Wir denken, wir seien mit unseren iPhones und mit künstlicher Intelligenz so weit gekommen, aber unser Körper und unser Geist haben sich seit fünfzigtausend Jahren kaum verändert. Wir sind biologisch immer noch auf Verbindung gepolt. Groß angelegte Studien haben gezeigt, dass Stress, verursacht durch chronische Einsamkeit, zu den ungesündesten Dingen überhaupt gehört (Petitte et al 2015: 113–132). Dieser Stress lässt uns schneller altern, Krebs tödlicher werden, Alzheimer schneller fortschreiten und macht unser Immunsystem schwächer (Cacioppo 2014: 3). Einsamkeit ist statistisch gesehen tödlicher als Übergewicht (Victor/Bowling 2012: 313–331) und genauso tödlich wie eine Schachtel Zigaretten am Tag (Spiegel Wissenschaft 2010). Und das Gefährlichste daran ist: Ist die Einsamkeit erst einmal chronisch, kann es zu einem Teufelskreis kommen. Physischer und emotionaler Schmerz wirken auf ähnliche Weise, denn beide weisen uns auf Bedrohungen hin. Deshalb löst sozialer Schmerz auch sofort Verteidigungsverhalten aus. Einsamkeit aktiviert in unserem Gehirn den Selbstverteidigungsmodus. Plötzlich sieht man in allem eine potenzielle Gefahr. Aber damit nicht genug. Studien zufolge ist unser Gehirn viel empfänglicher für soziale Signale, wenn wir einsam sind (Vanhalst et al. 2015). Gleichzeitig werden wir schlechter darin, sie richtig zu interpretieren – dafür müsste der ventrale Vagus aktiv sein, der dafür aber ein Gefühl von Verbundenheit und Gesehenwerden braucht. Das heißt, wir nehmen andere stärker wahr, es fällt uns aber schwerer, sie zu verstehen. Der Teil unseres Gehirns, der für Gesichtserkennung zuständig ist, gerät aus dem Gleichgewicht und neigt dazu, neutrale Gesichter als feindselig zu interpretieren (Yoon/Zinbarg 2008: 680–685). Wir werden misstrauisch. In der Einsamkeit denken wir, dass die ganze Welt uns etwas Böses will. Diese Wahrnehmung kann dazu führen, dass wir ichbezogener werden, um uns selbst zu schützen. Auf andere wirken wir dann kälter, unfreundlicher und sozial inkompetenter, als wir es tatsächlich sind. Wenn Einsamkeit dein Leben bestimmt, kannst du als Erstes versuchen, den Teufelskreis zu erkennen, der dich vielleicht gefangen hält. Meistens sieht der so aus: Ein anfängliches Gefühl der Isolation führt zu Anspannung und Traurigkeit, wodurch deine Wahrnehmung sich auf negative Interaktionen mit anderen fokussiert. Du interpretierst das Verhalten deiner Mitmenschen so, als würden sie nichts mit dir zu tun haben wollen. Dadurch wird deine Meinung von dir selbst und anderen schlechter. Dann ändert sich dein Verhalten und du fängst an, soziale Interaktionen zu meiden. Das fördert wiederum die Isolationsgefühle. Es wird mit jedem Mal schwerer, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Einsamkeit führt dazu, dass du dich von anderen wegsetzt, dass du Anrufe von Freunden nicht beantwortest und Einladungen ausschlägst, bis sie ausbleiben. Social Media wird zum Ersatz echter menschlicher Interaktion. Facebook, Instagram und TikTok als Droge, die unabhängig vom Alter konsumiert werden kann, weil es keine Altersverifikation gibt. Jeder von uns hat ein Bild von sich selbst. Wenn du dich selbst als einen Menschen siehst, mit dem man nicht gerne zusammen Zeit verbringt, weil du von dir selber denkst, dass du zum Beispiel nicht interessant genug bist, dann nehmen auch andere das wahr. Du verhältst dich entsprechend deines Selbstbilds und schließlich wird die echte Welt so, wie du dich im Inneren fühlst. Der erste Schritt, den du tun kannst, ist, zu akzeptieren, dass dieses Gefühl da ist und dich in erster Linie nur schützen möchte. Es ist nichts, wofür du dich schämen musst. Du kannst dieses Gefühl nicht loswerden oder ignorieren, aber du kannst es annehmen und an seinen Ursachen arbeiten. Du kannst dir bewusst machen, was dich bedrückt, und herausfinden, ob du die Sache vielleicht zu negativ interpretierst. War dein Zusammentreffen mit deinem Kollegen wirklich so negativ oder war es vielleicht nur neutral oder sogar positiv? Was ist wirklich bei eurer Interaktion passiert? Hat dein Gegenüber wirklich etwas Negatives gesagt oder hast du es nur so ausgelegt? Vielleicht war die andere Person nur im Stress und wollte gar nicht abweisend sein. Wie ist es mit deiner Meinung von der Welt? Gehst du davon aus, dass andere grundsätzlich schlechte Absichten haben? Weißt du zu Beginn einer sozialen Interaktion immer schon, wie es ausgeht? Denkst du, dass andere dich nicht dabeihaben wollen? Vermeidest du es, dich anderen zu öffnen, aus Angst davor, verletzt zu werden? Wenn wir uns bewusst sind, dass wir als Menschen auf tiefste Verbundenheit ausgerichtet sind und unser größter Schmerz in der Trennung liegt, dann ist klar, dass die Trennung für uns etwas sehr Bedrohliches ist und wir Verbindung benötigen, um uns in dieser Welt sicher und aufgehoben zu fühlen. Aber warum gibt es dann so viel Ungebundenheit in unserer Gesellschaft – abgesehen von den strukturellen Gründen, die ich weiter oben aufgezeigt habe? Dafür schauen wir uns noch einmal das natürliche menschliche Verhalten unter Gefahr an: In dem Moment, in dem wir uns bedroht fühlen, ist unsere Reaktion zuallererst, in die Verbindung zu gehen. Wir sind Herdentiere und versuchen uns an anderen zu orientieren, wenn wir gestresst sind. Es gibt aber die Fähigkeit bei uns Menschen, dass wir uns der Umgebung anpassen, in der wir leben. Wir entwickeln dazu Strategien, um mit dem, was ist, besser klarzukommen. Wenn wir also die Erfahrung gemacht haben, dass uns die Bindungssuche in Not nicht gutgetan hat, dann kann sich daraus die Strategie entwickeln, dass wir uns unter Not abwenden, anstatt nach Hilfe zu suchen. Emotionale Vernachlässigung in der Kindheit ist häufig der Grund für die chronische Einsamkeit im Erwachsenenalter. Unter emotionaler Vernachlässigung versteht man das Gefühl, als Kind nicht gesehen zu werden oder mit seinen Bedürfnissen oder der eigenen Not nicht wahrgenommen zu werden. Es ist ein Gefühl von Ablehnung in Situationen, die sehr emotional sind, oder die Erfahrung, mit dem eigenen Schmerz nicht ernst genommen zu werden. Wenn die Bindungspersonen emotional nicht verfügbar waren, erlebten wir Einsamkeit. Es war ein Gefühl von Trennung, ein Gefühl von Unverbundenheit zur primären Bezugsperson. Dieses Gefühl ist für ein Kind höchst bedrohlich und sehr schmerzhaft. Der Begriff, mutterseelenallein zu sein, kommt nicht von ungefähr und beschreibt sehr passend das tiefe Empfinden von Einsamkeit. Das Gefühl der Einsamkeit bleibt immer bestehen, sobald wir in einem gestressten und dysreguliertem Zustand nicht aufgefangen werden. Die Angst vor Ablehnung kann dazu führen, dass man Angst hat, sich zu zeigen. Das macht einsam – privat wie auch beruflich. Egal, ob wir Einsamkeit als rein subjektives Problem betrachten, das nur das Wohlbefinden von einzelnen Personen betrifft, oder als Bedrohung für die Volksgesundheit: Wir müssen diesem Thema mehr Aufmerksamkeit schenken. Wir Menschen haben uns eine grandiose neue Welt aufgebaut und trotzdem können die Dinge, die wir uns erschaffen haben, nicht unser grundlegendes biologisches Bedürfnis nach Nähe ersetzen. Das, was wir benötigen, bekommen wir voneinander. Daher sollte unser Fokus darauf liegen, dass Menschen ihrem natürlichen Bedürfnis nach echter Verbundenheit nachkommen können. Bei allem, was die Digitalisierung an Positivem mit sich bringt, sollten wir ein Auge darauf halten, dass sie uns von unserer Natur nicht abhält. Psychologische Sicherheit beginnt mit dem Start ins Leben Um als Erwachsener ein mit sich selbst und anderen verbundener Mensch sein zu können, benötigen wir primär in unserer Kindheit das Gefühl von psychologischer Sicherheit und Verbundenheit. Ansonsten wird es uns später schwerfallen, der Mensch zu sein, der wir eigentlich sind. Menschen, die in ihrer Kindheit Ohnmacht und Hilflosigkeit erfahren haben, werden im Erwachsenendasein diese Unsicherheit auch spüren. Die Ursache für ihre Ängste und Unsicherheiten liegen in ihrer Vergangenheit, die Symptome zeigen sich jedoch in der Gegenwart. Existenzangst, Selbstzweifel, Angst vor neuen Aufgaben oder vor Veränderungen sind nur ein kleiner Auszug der Folgesymptomatik. Das Fatale daran ist, dass viele Menschen diese Symptome als normal annehmen, weil sie andere Menschen sehen, denen es auch so geht. Hinzu kommt, dass den wenigsten der Zusammenhang zwischen Ursache und Symptom bewusst und damit nicht oder nur schwer auflösbar ist. Für eine psychologisch sichere Gesellschaft braucht es selbstsichere Menschen – primär, wenn sie Menschen führen oder Kinder aufziehen oder betreuen. Daher sollte an die Ursache gegangen und dafür gesorgt werden, dass Kinder in einer angstfreien Umgebung aufwachsen können. Das geht über zwei Wege: Wissensvermittlung über die Hintergründe von psychologischer Sicherheit und was das Fehlen derselben in der Kindheit für Folgen hat. Dieses Wissen benötigen insbesondere die Menschen, die Kinder aufziehen und betreuen. Es braucht Strukturen, in denen die Menschen, die Kinder aufziehen und betreuen, sich psychologisch sicher fühlen. Das heißt, dass sie in einem Zustand eines regulierten Nervensystems leben und arbeiten können.Psychologische Sicherheit beginnt schon im Mutterleib Wenn von Bildung gesprochen wird, denken die meisten an Schule, Ausbildung und Studium. Ich möchte den Begriff ausweiten. In meinen Augen beginnt das Thema Bildung ab dem Tag, an dem ein Mensch auf die Welt kommt. Ich meine damit keine kognitive Wissensvermittlung. Das wäre, wie du nun weißt, in den ersten Lebensjahren von der Gehirnentwicklung her schon nicht möglich. In dieser Phase des Lebens geht es viel um ein Lernen über Erfahrungen, die Babys machen. Erfahrungen, in denen sie das Gefühl von Sicherheit über verlässliche Bindung erhalten. Damit sie als erwachsene Personen ein weites Stresstoleranzfenster haben und somit ein grundsätzliches Vertrauen in das Leben und sich selbst. Denn das ist Grundlage dafür, dass sie gesunde erwachsene Menschen werden, die ihr Potenzial leben können. Damit Babys und Kleinkinder diese Erfahrungen machen können, brauchen sie Bindungspersonen, die sich bewusst darüber sind, wie wichtig eine sichere Bindung für den weiteren Verlauf im Leben ist. Aber nicht nur das Wissen darum ist wichtig, viel entscheidender ist, dass Eltern selbst Menschen sind, die in Beziehung gehen und gerade auch in herausfordernden Situationen in der Verbindung zu ihren Kindern bleiben können. Einige Eltern handeln intuitiv so, dass sie ihren Kindern eine verlässliche Bezugsperson sind. Ein großer Teil unserer Gesellschaft hatte aber selbst in der Kindheit ambivalente Bezugspersonen und hat daher im Hier und Jetzt Schwierigkeiten, liebevolle und tiefe Beziehungen leben zu können. Es wird unbewusst weitergegeben, was man selbst erlebt hat. Häufig wird in dem Kontext von Vernachlässigung nur auf den Teil in unserer Gesellschaft geschaut, den man bildungsfern oder sozial schwach nennt. Aber gerade in der Bildungsschicht und in den akademischen Berufen gibt es viele Eltern, die noch sehr stark mit sich selbst beschäftigt sind, denen ihre berufliche Karriere ungeheuer wichtig ist, die sich selbst verwirklichen, viel erleben und das Leben genießen wollen. Sie kümmern sich intensiv um ihr Aussehen, ihre Hobbys, ihre Wohnungseinrichtung und um die Anschaffung und Zurschaustellung unterschiedlicher Statussymbole. Allerdings sind Kinder solch selbstbezogener Eltern bei der Verwirklichung ihrer individuellen Ziele eher hinderlich, und sie werden ihnen mit ihrem Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, Geborgenheit und Zuwendung leicht lästig. Meist tun diese Eltern ihre Pflicht, jedenfalls das, was sie für ihre Pflicht halten, und das meistens sogar besonders gut. Sie sorgen für eine besonders ausgewogene Ernährung, für Sauberkeit und hygienische Verhältnisse, ansprechende, modische Kleidung und beschaffen sich alle möglichen Gerätschaften, von denen sie glauben, sie seien wichtig für ihr Kind. Sie beruhigen ihr (schlechtes) Gewissen, indem sie das Kind nach Kräften verwöhnen. Was ihr Kind aber wirklich braucht, sind Eltern, die ganz und gar da sind und sich ihm emotional, geistig und körperlich zuwenden, wenn es verunsichert ist und Angst hat. Aber genau das schenken diese Eltern ihren Kinder nicht oder zumindest nicht dann, wenn diese es besonders dringend brauchen. Kinder, die materiell alles bekommen, denen aber emotionale und psychologische Sicherheit vorenthalten bleibt, sind oft bereits sehr früh gezwungen, Strategien zu entwickeln, um mit dieser Unsicherheit klarzukommen. Meist handelt es sich dabei um sehr rigide, einseitige, pseudoautonome Strategien der Angstbewältigung (Gebauer/Hüther 2004). Aufgrund der Neuroplastizität unseres Gehirns werden die dabei aktivierten neuronalen Verschaltungen umso nachhaltiger gebahnt, je früher und je häufiger sie eingesetzt werden. Sie können das gesamte Fühlen, Denken und Handeln bestimmen. Nicht nur im Kindesalter, auch später als erwachsene Personen. Menschen, die bereits als Kinder keine sicheren Bindungen ausbilden konnten, haben Angst vor körperlicher und emotionaler Nähe. Ihnen fällt es schwer, anderen Menschen zu vertrauen. Ihr Verhalten ist das Ergebnis ihrer Strategien, sich zu schützen. Wenn es ihnen nicht gelingt, die Angst vor Nähe und Beziehung zu überwinden, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie in ihrem Leben isoliert, ichbezogen und bindungsunfähig bleiben (Grossmann 2012). Um den Teufelskreis zu durchbrechen, sodass Eltern ihre eigene Erfahrung von unsicherer Bindung nicht an ihre Kinder weitergeben, ist es unabdingbar, dass das Wissen darum für alle Menschen zugänglich ist und sie darin unterstützt werden, ihre eigenen Erfahrungen aufzuarbeiten. Denn nur sicher gebundene Menschen können als Erwachsene die Geborgenheit an ihre Kinder weitergeben und als Erwachsene tiefe Verbindung leben. Da Verbindung die Basis für psychologische Sicherheit ist, ist das die Grundlage dafür, dass eine psychologisch sichere Gesellschaft entstehen kann. Dieser Prozess kann über zwei Wege gegangen werden: Zum einen sollte die Psychoedukation zum Thema der psychologischen Sicherheit und der Bindungstheorie Bestandteil von Lehrplänen werden. Das schafft bei Kindern und Jugendlichen schon früh Bewusstsein für das Thema. Einerseits zur Reflexion des Bindungsstils ihrer Bezugspersonen – und daraus abgeleitet die Erkenntnis, dass mit ihnen selbst alles in Ordnung ist und sie okay sind – und andererseits zur Reflexion des eigenen Gefühls, was Nähe und Verbindung angeht. Zudem fördert das Hintergrundwissen zu den Themen das Verständnis für das Verhalten unserer Mitmenschen. Wir urteilen weniger schnell, weil wir wissen, dass es Gründe für die Gefühle und das Verhalten der anderen gibt. Zum anderen sollte seitens der Politik und der Medien dem Thema mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit geschenkt und parallel werdenden Eltern Angebote noch während der Schwangerschaft gemacht werden. Sie sollten erfahren, wie wichtig es für Babys und Kinder ist, nicht nur gewärmt, genährt und sauber gehalten zu werden. Sondern dass Kinder die Erfahrung machen müssen, eine verlässliche Bindungsperson zu haben, die ihnen bei jeglichem aufkommenden Gefühl beiseitesteht und ihnen zeigt, dass es möglich ist – und später auch, wie es möglich ist –, Ängste zu überwinden. Es gibt bereits einige Angebote für Eltern. Die Stadt Köln beispielsweise unterstützt mit ihren Elternbriefen die Erziehungsberechtigten ab dem Zeitpunkt, an dem das Baby auf der Welt ist. In diesen Briefen werden die Entwicklungsschritte von Kindern beschrieben und mögliche Konflikte im Erziehungsalltag geschildert. Es werden keine Patentrezepte geboten, sondern die Briefe sollen dazu anregen, eigene Lösungen für die individuellen Probleme zu finden. Das kognitive Verstehen allein reicht aber nicht, damit Eltern sichere Bindungspersonen sein können. Oft sind Eltern selbst überfordert und unsicher. Das Kind ist häufig nicht die Ursache für die Überforderung und Unsicherheit der Eltern. Es verstärkt nur den empfundenen Stress und ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Das heißt, hier benötigen die Eltern im ersten Schritt Unterstützung, um wieder in ihre eigene Sicherheit und Handlungsfähigkeit zu kommen. Die Werkzeuge dafür sollte man ihnen schon vor Geburt ihres Kindes an die Hand geben und sie damit arbeiten lassen. Frauenärzte oder Hebammen könnten diese Aufgabe übernehmen oder von Experten übernehmen lassen, die vor Ort und jederzeit ansprechbar sind. Das Angebot sollte kostenlos und jedem frei zugänglich sein. Es ist eine Investition in die Zukunft dieser ungeborenen Babys und etwas, von dem wir als Gesellschaft profitieren werden. Zudem werden dieses Wissen und die erlernten Methoden einen positiven Effekt auf das Nervensystem der Eltern und ihren Zustand haben. Davon profitiert auch das Baby im Bauch der Mutter. Denn bei dauerhaftem Stress können Stresshormone wie Cortisol die Plazenta-Schranke passieren und möglicherweise in Verbindung mit anderen Faktoren die Entwicklung des kindlichen Gehirns negativ beeinflussen. Untersuchungen konnten beispielsweise zeigen, dass Kinder von übermäßig gestressten Müttern ein schwierigeres Temperament entwickeln können (Haselbeck 2012: 13): Der Säugling reagiert auf neue Reize mit mehr Unbehagen und lässt sich schwerer beruhigen. Chronischer Stress im Verlauf der Schwangerschaft kann zudem Auswirkungen auf die Entwicklung kognitiver, emotionaler und sozialer Fähigkeiten beim Baby haben und das Risiko für psychische Erkrankungen des Kindes, wie Angststörungen oder auch Depressionen, erhöhen. Psychologische Sicherheit entwickelt sich demnach schon pränatal. Die Erfahrungen der ersten Lebensjahre, gerade in Bezug auf unsere Bindungspersonen, haben danach ebenfalls einen großen Einfluss darauf. Hier braucht es mehr Angebote für werdende Eltern. Zum einen, um ihnen die Wichtigkeit des Themas bewusst zu machen, und zum anderen, um sie zu unterstützen, in ihre eigene Sicherheit zu kommen. Denn so wie in Unternehmen Teams sichere Führungskräfte benötigen, um sich zu entwickeln, so brauchen Kinder sichere Eltern, um sich zu gesunden erwachsenen Menschen entwickeln zu können. Psychologische Sicherheit in Kindertagesstätten Mit einem Jahr, spätestens mit drei Jahren kommen die meisten Kinder in die außerelterliche Betreuung. Zur Tagesmutter oder in den Kindergarten. In einer Prognose der Bertelsmann Stiftung fehlen jedoch im Jahr 2023 384 000 Kitaplätze in Deutschland (Tagesschau 2022). Um den Betreuungsbedarf zu erfüllen, müssten zusätzlich zum vorhandenen Personal weitere achtundneunzigtausendsechshundert Fachkräfte eingestellt werden. Personal, das jetzt schon nicht da ist. Das Fatale an dieser Situation ist aber nicht nur, dass so viele Kinder keinen Kitaplatz erhalten, sondern auch die Folgen, die der Personalmangel auf den bestehenden Alltag in einer Kita hat. Immer mehr Erzieher in Deutschland arbeiten an der Belastungsgrenze und sind am Ende ihrer Kräfte (Tagesschau 2023). Dass ein Personalmangel den rein operativen Betrieb einer Kita negativ beeinflusst, liegt auf der Hand. Das Bewusstsein dafür, dass Erzieher dadurch dauerhaft außerhalb ihres Stresstoleranzfensters arbeiten, ist in meiner Beobachtung allerdings nicht vorhanden oder es wird seitens der Politik weggeschaut. Letzteres scheint wahrscheinlicher, denn das Bundesministerium für Gesundheit beschreibt auf einer Website, deren Inhalte das Ministerium verantwortet, sehr treffend, was für negative Folgen Stress auf Körper und Psyche hat (Stress: Auswirkungen auf Körper und Psyche 2022). Menschen, deren Nervensystem dauerhaft in der Übererregung ist, können sich psychisch nicht sicher fühlen und sind in vielen Alltagssituationen überfordert. Deshalb ist dem betreuenden Personal unserer Kinder kein Vorwurf zu machen, wenn ihre Impulskontrolle einmal nachgibt und sie daraufhin beispielsweise herumbrüllen. Sie können nicht anders, auch wenn sie erwachsen sind und man ihnen vorwerfen möchte, dass sie sich doch unter Kontrolle haben sollten. Es geht schlicht nicht, das Nervensystem lässt es ab einem bestimmten Punkt nicht mehr zu – jeder Elternteil weiß aus eigener Erfahrung, dass es diese roten Linien gibt. Im Fall der Erzieher ist es eine Konsequenz der Bedingungen, unter denen sie arbeiten. Vor diesem Hintergrund verwundert es auch nicht, dass in Kitas immer noch zu Maßnahmen wie dem stillen Stuhl gegriffen wird, um Kleinkinder in den Griff zu bekommen, wenn sie sich beispielsweise streiten und körperlich werden. Doch dort, wo es im kindlichen Streit aufgrund von in dem Alter noch fehlender Impulskontrolle zu Hauen und Kratzen kommt, braucht es weniger eine Bestrafung in Form des stillen Stuhls. Es bräuchte vielmehr eine Hinwendung und ein In-Beziehung-Gehen mit den beiden Streithähnen. Dafür wird aber Zeit benötigt, die die Erzieher oft nicht haben. Das heißt, neben den gesundheitlichen Folgen für die Mitarbeiter haben der Personalmangel und der damit verbundene Stress auch Auswirkungen auf die betreuten Kinder. Menschen, die in Systemen arbeiten, die zur Überforderung führen und in denen psychologische Unsicherheit an der Tagesordnung ist, können unseren Kindern keine sicheren Begleiter sein. Aber noch mal, um an dieser Stelle nicht missverstanden zu werden: Es ist das System, das geändert werden muss. Den Erziehern darf meistens kein Vorwurf gemacht werden. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, bei denen Erzieher zu weit gehen und wissentlich Kindern seelische und körperliche Gewalt antun. Da es derzeit aber nicht nur einen Personalmangel bei den Erziehern gibt, sondern auch Kita-Aufsichtsbehörden überlastet sind, wird der seelischen und körperlichen Gewalt an Kindern in Kitas nicht so nachgegangen, wie es erforderlich wäre (Tagesschau »Gewalt in Kitas – Wenn kleine Kinder Zeugen sind« 2023). Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) hat recht, wenn er sagt, dass bei der Lösung des Personalmangels in den Kitas vor allem der Bund in der Pflicht ist. Es muss als nationale Aufgabe verstanden werden, das Kitasystem zu finanzieren und zu unterstützen. Tomi Neckov, der stellvertretende Bundesvorsitzende des Verbandes, fordert: »Die frühkindliche Bildung braucht, hier gibt es keine zwei Lesarten, massive Investitionen – jetzt und dauerhaft« (Tagesschau »Es geht nicht mehr« 2023). Auch wenn der Satz abgedroschen klingt, so liegt in ihm doch ganz viel Wahrheit: »Die Investition in unsere Kinder ist eine Investition in unsere Zukunft.« Wie sollen Kinder, die schon von klein auf Stress und Überforderung in ihrem Umfeld dauerhaft miterleben, selbst zu sicheren erwachsenen Menschen heranreifen? Jedoch genau das braucht unsere Gesellschaft, um mit den Herausforderungen unserer Zeit umgehen zu können. Wir benötigen erwachsene Menschen, die sich innerhalb ihres Stresstoleranzfensters bewegen, damit sie bewusst aus ihrem präfrontalen Neokortex heraus agieren können und nicht von autonomen Stressreaktionen gelenkt werden. Psychologische Sicherheit in der Schule Psychologische Sicherheit ist der Zustand eines Menschen, in dem er keine Angst hat und nicht gestresst ist. Aus diesem Zustand heraus kommt er an sein Potenzial und kann sein wahres Sein zeigen. In einem solchen Zustand funktioniert auch das Lernen am besten (Drimalla 2018). Wenn man mit diesem Blick auf unser Schulsystem schaut, muss man feststellen, dass Schule kein Ort ist, an dem psychologische Sicherheit für auch nur einen der Beteiligten gegeben ist. In Deutschland wird fast jeder dritte Schüler gemobbt (Liebsch 2019). Dabei bleibt es nicht nur bei Beleidigungen, auch körperliche Gewalt steht auf der Tagesordnung. Lehrer sind oftmals überlastet und das nicht erst seit der Corona-Pandemie (Blossfeld et al. 2014). Lehrkräfte leiden mehr als viele andere Berufsgruppen unter psychischen Erkrankungen und Erschöpfung bis hin zum Burn-out. Die öffentliche Wahrnehmung des Lehrerberufs ist aber häufig eine andere. Der Unterricht findet in der Schule, die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, die Korrekturen von Arbeiten oder die Kontakte zu den Eltern finden meist zu Hause statt. Der geteilte Arbeitsplatz bedingt, dass der Lehrerberuf von vielen als Halbtagsjob gesehen wird. Dabei bringt die Tätigkeit an sich hohe Herausforderungen mit sich. Lehrkräfte sind in ständiger Interaktion. Während sie der Unterrichtsgestaltung nachkommen, müssen sie gleichzeitig mit den Bedürfnissen in der Klasse umgehen und darauf achten, alle Schüler mitzunehmen. Das Gelingen des Unterrichts setzt eine hohe Kooperationsbereitschaft der Schülerinnen und Schüler voraus. Gelingt die notwendige Kooperation im Unterricht nicht, kommt ein weiterer Stressfaktor dazu: der hohe Lärmpegel, der oft eine Folge von Unruhe in der Klasse ist (Anders 2020). Früher ist man dem Herr geworden, indem man mit Bestrafung und Drohung gearbeitet hat. Schule war ein Ort, an dem Zucht und Ordnung herrschten. Es wurde dem Lehrer gehorcht. Diese Schüler wurden dann in Unternehmen entlassen, in denen solche Mitarbeiter gebraucht wurden: Mitarbeitende, die gehorchen und ausführen, was man ihnen sagt und ihnen vorlegt. Heutzutage fordern Unternehmen allerdings andere Qualitäten von ihren Mitarbeitenden. Sie sollen kreativ sein, selbstständig denken und bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Im besten Fall fördern die zehn bis dreizehn Schuljahre ein solches Verhalten. Damit das gelingt, braucht es aber andere Rahmenbedingungen, damit Schule dieser Anforderung gerecht werden kann und wissbegierige, selbstständige junge Erwachsene in das Arbeitsleben entlässt. Vor allem werden dafür zum einen Lehrer gebraucht, die bereit sind, einen Unterricht auf Augenhöhe zu gestalten, und zum anderen die Voraussetzungen, um überhaupt einen solchen Unterricht durchführen zu können. Für Kooperationsbereitschaft braucht es Beziehung, also den Aufbau von Verbindung. Diese menschliche Verbindung zahlt auf das Gefühl von Sicherheit ein. Die dadurch gewonnene Sicherheit zahlt sich auf verschiedene Bereiche aus. Wenn ein Schüler ein gutes Verhältnis zu seinem Lehrer hat und weiß, dass dieser es grundsätzlich gut mit ihm meint, wird er viel eher kooperieren und bereit sein, dem Unterricht zu folgen. Zudem würde er sich dieser Lehrkraft auch eher mit seinen Problemen anvertrauen. Die Forschung bestätigt das. Kinder benötigen, um sich gut zu entwickeln und gut zu lernen, nicht in erster Linie Disziplin, sondern vor allem gute Beziehungen zu Eltern und Lehrern, denn gerade Kinder sind Beziehungstiere (Bauer 2008). Angst und Stress sind hingegen Bildungskiller. Forscher haben neurobiologische Zentren für Motivation und Zielstrebigkeit entdeckt und dabei herausgefunden: Lebensfreude und Erfolgsstreben werden durch die Botenstoffe Dopamin, Oxytocin und Opioide gesteuert. Diese werden verstärkt oder vermindert ausgestoßen, je nachdem wie viel Interesse, Aufmerksamkeit, Anerkennung und persönliche Wertschätzung einem Menschen entgegengebracht wird – besonders einem Kind. Das ist die biologische Basis, auf der Handlungskonzepte für Schule entwickelt werden sollten. Nicht restriktive Gebote fördern die Leistungsbereitschaft der Schüler. Vielmehr müssen Unterrichtsbedingungen geschaffen werden, die jedem ein ausreichendes Maß an Ansprache und aufbauendem Feedback sichern. Es sollte darum gehen, die Qualität der Beziehungsgestaltung positiv zu beeinflussen. Zusätzlich sollte ein weiteres Phänomen im Unterrichtsalltag berücksichtigt werden: die Spiegelneurone (»Mirror Neuron System«, MNS). Sie ermöglichen unter anderem, sich in einen anderen Menschen hineinzuversetzen und Empathie aufzubringen. Sie führen auch dazu, dass ein Kind die ausgesprochene oder stillschweigende Erwartung von Eltern oder Lehrern verinnerlicht – genauer: sich diese Erwartung in Form von neuronalen Netzwerken in seinem Gehirn einnistet. Deshalb sollten Lehrer in der Kommunikation mit dem Kind auch immer dessen Potenziale und Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen. So kann es eine positive Vision seiner selbst und – getreu dem Kreislauf des Selbstbilds – die Kraft einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung entwickeln. All das erfordert, dass ein Lehrer individuell auf jedes einzelne Kind eingehen kann. Aber wie soll das gelingen in einer Klasse mit dreißig Schülern und einer Lehrperson, die neben dem Unterricht auch noch zusätzliche Aufgaben und Ämter übernehmen soll? Und wie soll das einer Lehrkraft gelingen, die selbst überlastet ist und sich nicht innerhalb ihres Stresstoleranzfensters befindet? Dabei zeigt die Forschung zur Lehrergesundheit, dass der höchste Belastungsfaktor, also der Umgang mit Schülern, zugleich auch die stärkste Ressource für Lehrkräfte ist. Wenn der Umgang gut funktioniert, dann ergibt sich daraus auch der größte positive Rückhalt für die Lehrergesundheit. Ebenso verhält es sich mit dem zweiten Stressfaktor, der Zusammenarbeit im Kollegium: Wenn die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen sowie mit der Schulleitung gut läuft, stärkt auch das die Lehrergesundheit. Im Bildungswesen psychologische Sicherheit über Verbindung herzustellen, zahlt sich demnach für alle aus: für Lehrer und Kinder und damit am Ende auch für uns als Gesellschaft. Um Gerald Hüther zu zitieren: »Wird das Leben als erkenntnisgewinnender Prozess verstanden, so ist jeder Mensch ein lebenslang Lernender. Und geht es beim Lernen, wie die Hirnforscher inzwischen belegen können, um die Verankerung von individuell gemachten Beziehungserfahrungen in Form struktureller Beziehungsmuster auf der Ebene neuronaler Netzwerke, dann ist jeder Lernprozess Ausdruck und Resultat einer von einem Menschen gemachten Beziehungserfahrung.« Die Freude am Lernen ist also abhängig von den erlebten Lernsituationen und der dabei wahrgenommenen Zufriedenheit. Diese wiederum werden beeinflusst von der Qualität der sozialen Beziehungen im Lernumfeld. Wenn Lern- und Bildungsprozesse Beziehungen anbieten und befördern, bekommen Schüler während ihrer Schulzeit viel mehr mitgegeben als bloße Wissensvermittlung. Sie lernen, in Verbindung zu gehen, und können allein darüber zu selbstsicheren Menschen werden. Anzustreben ist somit eine Situation, in der die Schüler sich in der Verbindung zu ihrem Lehrer und ihren Mitschülern sicher fühlen. Im besten Fall macht es ihnen Spaß zu lernen und sie gehen in ihrer Tätigkeit auf, obwohl es für sie kognitiv anspruchsvoll und anstrengend ist. Um das Thema »Beziehungsaufbau und Verbindung« wird man nicht herumkommen, wenn man Schule als psychologisch sicheren Ort kreieren möchte, an den die Schüler gerne kommen. Hinzu kommt, dass Lernen zwei verschiedene Wirkungsmechanismen aufweist. Es ist ein subjektiver Vorgang, der von außen nur bedingt steuerbar ist. Lernen im Sinne eines Herbeiführens von Veränderung ist nur von innen heraus durch Reflexion und Einsicht lenkbar (Arnold/Pachmer 2013). Diese Perspektive muss aber dahingehend relativiert werden, dass trotz dessen der äußere Rahmen und die Art des Umgangs mit der Person Einfluss auf Reflexionsprozesse haben. Die Veränderung der Lernkultur in Richtung einer stärkeren Berücksichtigung sozialer Beziehungen ist aus meiner Sicht erstrebenswert, aber auch verbunden mit einer generellen gesellschaftlichen Diskussion. Die stärkere Ausrichtung von Schule auf Beziehungsgestaltung hat Auswirkungen auf die Rolle der Lehrkräfte und auf ihr Agieren in der Lehrsituation. Das wiederum hätte zur Folge, dass die Ausbildung zum Beruf des Lehrers neu gestaltet werden müsste. Damit ist erkennbar, wie sehr das Thema der psychologischen Sicherheit viele Bereiche unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens betrifft, wenn man es zu Ende denkt. Essenz Die Basis für psychologische Sicherheit ist das Gefühl von Verbundenheit. Um dort in unserer Gesellschaft hinzukommen, benötigen wir zum einen das Wissen um die Hintergründe von psychologischer Sicherheit in den Köpfen der Menschen. Zum anderen benötigen wir sichere Begleiter. Insbesondere für unsere Kinder in den Rollen Elternteil, Erzieher und Lehrer. Aber auch später als Führungskräfte, Coaches und Berater, die in Unternehmen arbeiten und die es sich zur Aufgabe gemacht haben, einen psychologisch sicheren Ort zu schaffen, an dem ihre Mitarbeitenden ohne Angst vor Bewertung ihr Potenzial und ihre Kreativität leben können. Wenn man noch weiterdenkt, sollten auch die Berufsgruppen, die kranke oder pflegebedürftige Menschen behandeln und begleiten, um die Wichtigkeit von psychologischer Sicherheit wissen. Sie sollten ebenfalls sichere Begleiter sein, die eine Beziehung zu ihren Patienten aufbauen können und sie nicht nur als Objekt einer zu bewältigenden Aufgabe sehen. Dass eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Arzt und Patient einen positiven Effekt auf die Heilung hat, ist mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen worden (Kamps 2017). In Beziehung zu gehen erfordert allerdings Zeit. Ein kostbares Gut, das im medizinischen und im Pflegebereich kaum vorhanden ist. Ein Faktor, der in diesem Bereich ein Umdenken und eine daraus folgende Änderung von Strukturen und Prozessabläufen erforderlich macht. ———————————————————————————————————– Die Autorin Birgit Schumacher interessierte sich schon in ihrem Volkswirtschaftsstudium für die Beantwortung der Frage, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit Menschen kooperieren und gut zusammenarbeiten können. In ihrer praktischen Arbeit als Wirtschaftsmediatorin und Coach unterstützt sie Führungskräfte und Geschäftsführer*innen dabei, ein Umfeld zu etablieren, in dem die Mitarbeitenden neue Ideen einbringen und Problemstellungen selbstorganisiert lösen. In Workshops und Vorträgen gibt sie Einblick in das Thema der psychologischen Sicherheit und zeigt Ansätze auf, die dafür notwendig sind. » https://birgitschumacher.net/ |
Franz Erni
Kommentare